
Orgelstadt Innsbruck
Eine Initiative des Kulturamtes der Stadt Innsbruck
Tobias Rettenbacher, Markus Margreiter
Einleitung
Innsbruck, die Hauptstadt des Bundeslandes Tirols, hat viele Namen: „Alpenstadt“, „Stadt am Inn“, „Olympiastadt“, „Kulturstadt“ und zu Recht auch „Orgelstadt Innsbruck“. Innsbruck besitzt einen einzigartigen Orgelschatz, entstanden in den letzten sechs Jahrhunderten: In der Landeshauptstadt befinden sich die meisten erhaltenen historischen Orgeln österreichweit! Von besonderer Bedeutung sind dabei die erhaltenen historischen Instrumente aus dem 16. und 17. Jahrhundert.
Nach derzeitigem Erhebungsstand (Stand Januar 2025) befindet sich aktuell die beeindruckende Anzahl von 83 Pfeifenorgeln in Innsbruck sowie 17 weiteren Orgeln, welche sich über einen gewissen Zeitraum in Innsbruck befunden hatten, außerhalb Innsbrucks. Die insgesamt 100 noch existierenden Instrumente werden hier vorgestellt - mitsamt Basisinfos, Dispositionen, Fotos und Bemerkungen zur jeweiligen Orgel- und Bauwerksgeschichte. 43 Instrumente davon stammen von der Steinacher Orgelbauwerkstatt (erbaut von Joseph Reinisch bis Martin Pirchner).
Ein besonderer Dank gilt allen Seelsorgern, Mesnern, Kirchenmusikerinnen, Kirchenmusikern, Orgelbauern und Orgel-Verantwortlichen, welche behilflich waren, Kirchen und Gebäude aufsperrten, Informationen übermittelten und so wesentlich beitrugen zum Gelingen dieser Dokumentation.
Innsbrucker Orgelwelt
Bereits aus dem 15. Jahrhundert gibt es Berichte über Innsbrucker Orgeln bzw. Orgelbauer: - 1451 ließ sich Orgelbauer Gennschädel in Wilten nieder; - 1484 arbeitete der seinerzeit sehr geschätzte Orgelmacher Burkhard Dinstlinger in Innsbruck und hatte dabei auch mit Paul Hofhaimer, dem bedeutendsten Organisten seiner Zeit, Kontakt.
Zur Zeit Kaiser Maximilians I. (1490-1519) gab es in Innsbruck ein reges Musikleben und einen bereits reichhaltigen Instrumentenbestand. Leider sind aus dieser Zeit keine Orgeln mehr erhalten.
Die ältesten erhaltenen, wertvollsten Orgeln Innsbrucks stammen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts: - die 1558-61 von Jörg Ebert aus Ravenstein erbaute Schwalbennestorgel im Altarraum der Hofkirche, heute älteste spielbare Orgel mit Rückpositiv der Welt, ein einzigartiger Orgelschatz; - das ca. 1564-69 vom Innsbrucker Instrumentenbauer, Organist und Komponist Servatius Rorif gebaute18-registrige Claviorganum für Schloss Ambras, mittlerweile im Kunsthistorischen Museum Wien; - sowie die um 1585 von einem italienischen Orgelbauer erbaute Orgel in der Silbernen Kapelle neben der Hofkirche.
Auch aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert haben sich bedeutende historische Orgeln erhalten, wie z. B. die ca. 1650 erbaute Salve-Orgel und die ca. 1670 vom Brixner bzw. Innsbrucker Orgelbauer Daniel Herz in der Stiftskirche Wilten erbaute einstige Chororgel; oder die derzeit restaurierungsbedürftige einmanualige Brüstungsorgel in der Schlosskapelle Mariahilf in Schloss Mühlau, erbaut 1725 von Augustin Simnacher aus Tussenhausen. Das derzeit größte Instrument Innsbrucks ist die im Jahre 2000 von Orgelbau Pirchner ins historische Gehäuse von 1725 eingebaute 57-registrige dreimanualige Orgel im Dom zu St. Jakob mit insgesamt 3.729 Pfeifen! Die kleinste dokumentierte Innsbrucker Pfeifenorgel ist eine von Frédéric Clément in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaute 1-registrige Vogelorgel mit insgesamt nur 10 Metallpfeifen, genannt auch Serinette. Sie diente ursprünglich vermutlich wohl zum Abrichten von in Käfigen gehaltenen Singvögeln.
Von besonderer Bedeutung sind auch die Pfeifenorgeln im Stift Wilten wie z. B. die 53-registrige Verschueren-Festorgel auf der 2. Westempore und 14-registrige Reil-Chororgel im Altarraum, beide erbaut 2008; oder die historische Herz-Orgel auf der Nordempore, erbaut ca. 1670. Insgesamt befinden sich in der Stiftskirche Wilten sechs Pfeifenorgeln!
Möge diese Dokumentation zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Innsbrucks farbiger Orgelwelt anregen…
Orgeln in Innsbruck

Dom zu St. Jakob - Westempore

Dom zu St. Jakob - Gewölbe Altarraum, Fernwerk

Dom zu St. Jakob - Altarbereich, rechts

Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Altarraum

Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Lettner

Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Altarraum

Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Empore

Hofkirche - Silberne Kapelle

Hofburg-Kapelle - Kaiserliche Hofburg Innsbruck

Jesuitenkirche - Universitätskirche, 2. Empore

Jesuitenkirche - Universitätskirche, mobil

Innsbrucker Jesuitenkolleg - Hauskapelle

Kapuzinerkirche

Tiroler Landeskonservatorium

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 16

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 267

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 87

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 166

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 551

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 554
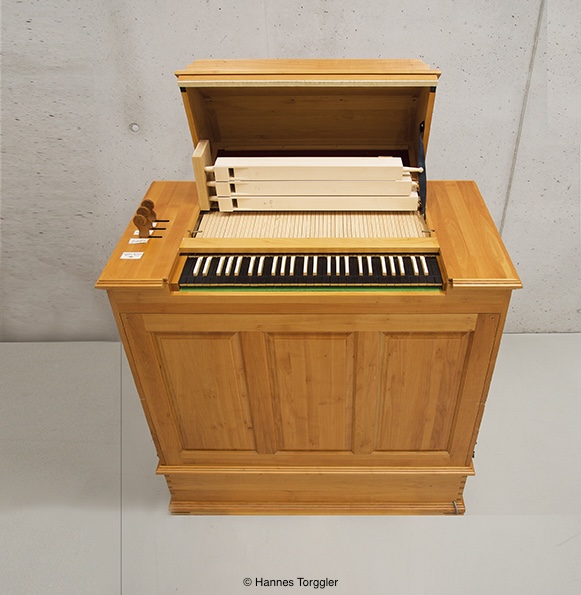
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 337

Chorverband Tirol - Haus der Musik, Leihorgel

Congress Innsbruck - Saal Tirol

Spitalskirche

Servitenkirche

Landhauskapelle - Altes Landhaus

Musikschule der Stadt Innsbruck - Reinhard Jaud Saal

Musikschule der Stadt Innsbruck - Vortragssaal

Musikschule der Stadt Innsbruck - Ursulinensaal

BORG Innsbruck - Proben-/ Orchesterraum

BORG Innsbruck - Festsaal

Serbisch-Orthodoxe Kirche (ehemalig Herz Jesu Kirche)

Neue Universitätskirche - Johanneskirche

Landschaftliche Pfarrkirche Mariahilf

Wohnung Mariahilf

Innsbrucker Abendmusik (Verein)

Pfarrkirche St. Nikolaus

Pfarrkirche Saggen

Klosterkirche der Barmherzigen Schwestern

Sanatorium Kettenbrücke - Hauskapelle

Privatwohnung Saggen - Musikzimmer, Orgel 1

Privatwohnung Saggen - Musikzimmer, Orgel 2

Evangelische Christuskirche

ORF-Landesstudio Tirol

Canisianum

Kloster zur Ewigen Anbetung

Pfarrkirche Dreiheiligen

Stiftskirche Wilten - 2. Westempore

Stiftskirche Wilten - Altarraum

Stiftskirche Wilten - Nördliche Seitenempore

Stiftskirche Wilten - Südliche Seitenempore

Stiftskirche Wilten - mobile Orgel

Stiftskirche Wilten - Erste Westempore

Wiltener Sängerknaben

Basilika Wilten

Pädagogische Hochschule Tirol

Pfarrkirche Wilten-West

Pfarrkirche Pradl

Schutzengelkirche Neu-Pradl

Pfarrkirche St. Norbert, Pradl-Süd

Auferstehungskirche

Pfarrkirche St. Paulus

Theresienkirche Hungerburg

Neue Pfarrkirche Hötting

Alte Pfarrkirche Hötting

Diözesanhaus Hötting

Priesterseminar Hötting, Seminarkirche

Privatwohnung Hötting

Pfarrkirche Allerheiligen

Volksschule Allerheiligen

Wohnhaus Allerheiligen

Pfarrvikariatskirche Kranebitten

Ursulinenkloster, Hauskapelle

Pfarrkirche Petrus Canisius

Pfarrkirche Mühlau

Schloss Mühlau, Kapelle Mariahilf

Karmel St. Josef und St. Theresa, Klosterkirche

Pfarrkirche Arzl

Kalvarienbergkirche Arzl

Pfarrkirche Amras

Pfarrkirche Vill

Pfarrkirche Igls

Wallfahrtskirche Heiligwasser
Dom zu St. Jakob - Westempore
Erbauer: Orgelbau Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 2000 Standort: Westempore Instrument: 57-registrige dreimanualige Schleifladenorgel mit vier Manualwerken und Pedal, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Die älteste urkundliche Nachricht von einer St. Jakobskirche in Innsbruck datiert aus dem Jahre 1271. Die Jakobskirche war über Jahrhunderte eine Filialkirche von Wilten; 1643 wurde St. Jakob eine selbstständige Pfarre. 1650 wurde das berühmte Gnadenbild von Mariahilf, geschaffen von Lucas Cranach dem Älteren, in die Pfarrkirche St. Jakob übertragen und am dortigen Hochaltar platziert, wodurch der Ort sich rasch zu einem Wallfahrtsort entwickelte.
1717-1724 erfolgte ein monumentaler Kirchenneubau, bei dem die alten (barock gestalteten) Langhausmauern der Vorgängerkirche verwendet wurden. 1725 erhielt die neugebaute Pfarrkirche eine neue zweimanualige Orgel, erbaut von Johann Caspar Humpel aus Meran, Südtirol. 1873, die Orgel besaß damals 26 Register, erfuhr das Instrument einen Umbau durch Joseph Sies aus Bozen, Südtirol.
Bereits neun Jahre später, im Jahr 1892, stellte Franz (II) Reinisch aus Steinach am Brenner eine neue zweimanualige 33- registrige mechanische Kegelladenorgel mit Barkermaschine fürs Hauptwerk ins barocke Humpelgehäuse hinein. Er übernahm aus der Vorgängerorgel insgesamt sieben Register, u. a. auch die Principal-Prospektpfeifen, welche, inzwischen in der untersten Oktav chromatisch ausgebaut, nicht mehr mit den genau gearbeiteten Schleierbrettern übereinstimmten. 1904 wurde die Innsbrucker Stadtpfarre zu einer Propstei erhoben.
In den 1920er Jahren bemühte sich Karl Koch, der damalige Kirchenmusiker und Chordirektor der Pfarre St. Jakob, um den Neubau einer zeitgemäßeren Orgel für die Pfarrkirche. Da sich das bestehende Orgelwerk in einem guten Zustand befand, wurde es im Dezember 1930 der Pfarre Hötting angeboten und 1931 auf die Westempore ihrer neu gebauten Pfarrkirche übertragen. Das barocke Gehäuse und der Pfeifenprospekt verblieben in der Pfarrkirche St. Jakob. Noch im gleichen Jahr baute Rieger Orgelbau aus Jägerndorf in Schlesien (als op. 2500) eine neue 75-registrige viermanualige elektropneumatische Orgel mit 56 Nebenregistern und Spielhilfen (darunter auch mit 5 Transmissionen) mit insgesamt 5500 Pfeifen ins bestehende Gehäuse ein, welches einst für eine 26registrige Orgel gebaut worden war.
Das Instrument, bei einem Bombentreffer am 16.12.1944 teilweise beschädigt, konnte gleich nach Kriegsende 1945 von der Orgelbauwerkstatt Karl Reinisch‘s Erben instandgesetzt und generalüberholt werden. 1979 führte der Nürnberger Orgelbauer Franz Heinze eine erneute Generalsanierung am Instrument durch. 1999 wurde das Orgelwerk ausgebaut und nach Wien (Josefstadt) auf die Empore der Pfarrkirche St. Franziskus Seraphius, Breitenfeld, übertragen.
2000 baute die Orgelbaufirma Pirchner aus Steinach am Brenner ins bestehende barocke Humpelgehäuse die mittlerweile vierte neue Orgel ein, eine 57-registrige dreimanualige mechanische Schleifladenorgel mit vier Manualwerken und Pedalwerk. Auf dem III. Manual des Instruments wird das Rückpositiv oder das Unterwerk gespielt; die beiden Werke können aber auch zusammen verwendet werden. Das Werk besitzt insgesamt 3.729 Pfeifen. Der Winddruck der Orgel beträgt 75 mmWS (für die Manuale) bzw. 90 mmWS (fürs Pedal).
Dom zu St. Jakob - Gewölbe Altarraum, Fernwerk
Erbauer: Rieger Orgelbau - Jägerndorf (Krnov), Schlesien (CZ) Baujahr: nach 1950 (Nachbau) Standort: Gewölbe im Altarraum Restauriert: 1993, Christian Erler, Schlitters im Zillertal, Tirol (A) Instrument: 10-registrige einmanualige pneumatische Orgel, freistehender Spieltisch Spieltraktur: elektropneumatisch Registratur: elektropneumatisch, Registerwippen
1931 baute Rieger Orgelbau aus Jägerndorf in Schlesien auf der Westempore der Pfarrkirche eine neue 75-registrigeviermanualige elektropneumatische Orgel, ein 10-registriges Teilwerk der Orgel errichtete er als Fernwerk im Gewölbe überdem Altarraum. Nach Zerstörung des Fernwerkes durch einen Bombenvolltreffer im vorderen Querschiff am 16.12.1944wurde es nach dem Krieg, nach 1950, von der Erbauerfirma wieder neu nachgebaut.
1993 restaurierte Orgelbauer Christian Erler aus Schlitters im Zillertal das Teilwerk, baute dabei ins rechte Chorgestühl imAltarraum einen Spieltisch mit Pedal für das Werk ein, entfernte zur besseren Hörbarkeit die Schwellwand im Gewölbe undbaute drei Transmissionen fürs Pedal ein. Das Fernwerk ist auch spielbar über einen zweiten Spieltisch (ohne Pedal), der sichim Gewölbe ober dem Altarraum direkt vor dem Fernwerk befindet. Als 1999 die Rieger-Orgel ohne das HumpelOrgelgehäuse aus dem Jahre 1725 in die Pfarrkirche Breitenfeld (Josefsstadt) nach Wien transferiert wurde, verblieb das 10-registrige Fernwerk im Dom zu St. Jakob im Innsbruck.
Dom zu St. Jakob - Altarbereich, rechts
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br. Tirol (A) Baujahr: 1986 Standort: 1986-2016 Propstei-Wohnung Domplatz; seit 2016 Dom zu St. Jakob, Altarbereich rechts Instrument: 1-registrige einmanualige Schleifladen-Truhenorgel Spieltraktur: mechanisch
Die 1-registrige Truhenorgel wurde 1986 von der Orgelbaufirma Reinisch-Pirchner aus Steinach am Brenner für Msgr. Peter Webhofer (1. Domkapellmeister von 1964-72 am Dom zu St. Jakob in Innsbruck) gebaut.
2016, nach dem Tod Msgr. Peter Webhofers, wurde das Instrument in den Dom zu St. Jakob (im Altarbereich rechts hinten) transferiert. Das Instrument besitzt ein Gehäuse mit verschließbaren Flügeltüren aus massivem Fichtenholz und eine tiefe kurze Oktav in der Manualklaviatur. Die Untertasten sind mit Ebenholz, die Obertasten mit Rindsknochen belegt.
Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Altarraum
Erbauer: Jörg Ebert - Ravensburg, Deutschland Baujahr: 1558-61 Umbauten: 1655, Daniel Herz - Brixen, Südtirol (I); 1700-01, Johann Caspar Humpel - Brixen, Südtirol (I) Restauriert: 1970 / 1976, Jürgen Ahrend- Leer, Friesland (D) Standort: Schwalbennest im Altarraum Instrument: 15-registrige zweimanualige Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, geschmiedete Registerschieber
Das Franziskanerkloster und die angrenzende Hofkirche am Rande der Altstadt, auch Schwarzmanderkirche (Schwarzmander = schwarze Männer) genannt, wurde von 1553 bis 1563 nach Plänen des Trientner Architekten Andrea Crivelli erbaut. Schon während der Bauzeit suchte die Innsbrucker Regierung nach einem geeigneten Orgelbauer.
1555 erhielt Orgelbauer Jörg Ebert aus Ravensburg den Auftrag zum Bau einer Orgel. An der Vorderseite des Klaviaturrahmens ist die Jahreszahl 1558 angegeben: Vermutlich waren zu diesem Zeitpunkt wesentliche Teile der Spielanlage fertiggestellt. Am 7. Juni 1561 berichtete die oberösterreichische Kammer dem Kaiser, dass die Orgel fertiggestellt sei, „... guett gemacht unnd [...] an der Prob gerecht befunden worden“ sei.
In den darauffolgenden Jahrhunderten erfolgten Reparaturen durch Georg Gemehlich aus Innsbruck (1606), Leopold Rotenburger aus Salzburg (1629), Daniel Herz mit seinem Gesellen Jacob Köck aus Brixen (1655), Johann Caspar Humpel aus Meran / Wilten (1701), Ignaz Franz Wörle aus Bozen (1748) und Johann Ev. Feyrstein aus Kaufbeuren (1772).In den 1790er Jahren wurde das gesamte Orgelgehäuse samt Schwalbennestempore weiß übertüncht. 1838 ersetzte Johann Georg Gröber aus Innsbruck die sechs Bälge durch drei größere, 1839 baute er eine Copl 8‘ ins Rückpositiv ein.
1861 stellte Josef Unterberger aus Innsbruck / Wörgl auf dem Brückenchor (Lettner) eine neue zweimanualige mechanische Orgel mit Kegelladen auf. Durch die gut funktionierende, neue Orgel wurde die inzwischen erneut reparaturbedürftige EbertOrgel nicht mehr verwendet. Zu Beginn der 1880er Jahre wollte die Ordensgemeinschaft der Franziskaner die nicht mehr benutzte Ebert-Orgel entfernen. Nach Bemühungen des aus Wien gebürtigen, in Innsbruck tätigen Architekten Josef Deininger, konnte die Orgel verbleiben. 1884-85 stellte man nach der Restaurierung und Freilegung des Fürstenchors vom weißen Kalkanstrich auch die Ebert-Orgel in ihrer ursprünglichen Gestalt wieder her; die stark beschädigten Außenbilder der Flügeltüren erneuerte man nach dem Originalvorbild. Vermutlich wegen Aufstellung eines neuen Uhr-Antriebes mussten damals die alten Bälge entfernt werden. Die Orgel war somit nicht mehr spielbar und hatte nur mehr eine optische Funktion.1944 erfolgte der Abbau der Ebert-Orgel und die Transferierung der Orgelteile in die Kapelle von Schloss Rotholz in Tirol.1945, gleich nach Kriegsende, brachte man diese wieder nach Innsbruck zurück und lagerte sie im Schloss Ambras ein.
Von 1954 bis 1962 begann die Restaurierung der Orgel durch Hubert Neumann aus Götzis, nach dessen plötzlichem Tod 1962 wurden die Orgelteile wieder im Schloss Ambras eingelagert.
1965 erhielt die Orgelbauwerkstatt Ahrend & Brunzema aus Ostfriesland den Auftrag zur Weiterführung der Restaurierungsarbeiten. In einem ersten Abschnitt erfolgte von 1965 bis 1970 der Wiederaufbau der Orgel, deren Spielbarmachung und die Rückführung auf den Zustand von 1561. Für den Orgelwind wurde eine Balganlage mit zwei Keilbälgen im Bälgeraum hinter der Orgel (mit Elektromotor) neu gebaut. 1973 wurden die Innenbilder der Flügeltüren restauriert. Von 1975 bis 1977 erfolgte der zweite Restaurierungsabschnitt durch Jürgen Ahrend. Die Außenseiten der Orgelflügel bekamen dabei einen neutralen Anstrich.
Am 23./24.9.1999 wurde die Orgel auf Wunsch von Orgelkustos Prof. Reinhard Jaud rein mitteltönig gestimmt. Der Winddruck des Instruments beträgt 90 mmWS. Die Ebert-Orgel ist das älteste zweimanualige Instrument mit Rückpositiv der Welt und die größte, nahezu unverändert erhaltene Renaissanceorgel Österreichs!
Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Lettner
Erbauer: unbekannt - Herkunft unbestimmt Baujahr: um 1600 (?) Standort: Brückenchor (Lettner) Instrument: 3-registriges Orgelpositiv (Kabinettorgel) Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, seitliche Registerschleifzüge
Laut dem Tiroler Volkskunstmuseum, welches das kleine 3-registrige Orgelpositiv als Kabinettorgel bezeichnet, wurde das mehrmals umgebaute Instrument um 1600 erbaut. Es besaß ursprünglich geteilte Register und statt der Mixtur wohl ein Regal 8‘.
Das Instrument vereinigt in sich stilistische Merkmale aus drei verschiedenen Kunstepochen; es besitzt an beiden Seiten des Oberteils Renaissance-Haltegriffe. Die Gehäusemalereien sind wesentlich jünger als die Gehäusewände und Gitterabdeckungen.
Ursprünglich war es wohl als Tischpositiv bzw. als Baldachinorgel mit zwei dahinterliegenden Keilbälgen erbaut worden, wie die heute verschlossenen Öffnungen an der Hinterseite der Windlade und an den beiden Keilbälgen zeigen. Die beiden Keilbälge befinden sich mittlerweile im später dazu gefügten Unterbau; sie können von Hand mittels Lederriemen aufgezogen werden. Auf der rechten Seite ragen die Schleifengriffe aus dem Instrument heraus, auf der linken Seite sind noch die später zugemachten Öffnungen für die Schleifen erkennbar.
1907 wurde das Instrument vom Tiroler Volkskunstmuseum bei einem Kunsthändler angekauft; es befindet sich mittlerweile auf dem Lettner der Hofkirche.
Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Altarraum
Erbauer: Johann Caspar Humpel - Meran, Südtirol (I) Baujahr: ca. 1680-1690 Restauriert: 1973-1975, Jürgen Ahrend- Leer, Friesland (D) Standort: Altarraum Instrument: 8-registrige einmanualige Kabinett-Orgel mit zwei Keilbälgen auf dem Gehäusedach Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Die Kabinett-Orgel, gebaut vermutlich zwischen 1680 und 1690 von Johann Caspar Humpel aus Meran, Südtirol, wurde 1907 von einem Kunsthändler in Meran in Südtirol erworben und befindet sich seither im Besitz des Innsbrucker Volkskunstmuseums. Am Unterrahmen der Orgel befinden sich vier schmiedeeiserne Tragbügel; durch sie können Traghölzer zum Transportieren des Instruments gesteckt werden.
Das Instrument wurde 1973 bis 1975 von Jürgen Ahrend aus Leer in Friesland restauriert. Dabei mussten u. a. 68 Metallpfeifen erneuert und das inzwischen fehlende Regal 8‘ neu gefertigt werden. Ahrend baute außerdem einen neuen Unterbau für das Instrument, in dem er einen kleinen Elektromotor platzierte; beide Keilbälge können jedoch nach wie vor auch händisch betätigt werden.
Von 1984 bis 1988 stand die Orgel als Leihgabe im Altarraum der Stiftskirche Wilten zwecks Begleitung des Chorgebets. Mittler-weile befindet sich das Instrument im Altarraum der Hofkirche seitlich links neben dem Hochaltar und wird gelegentlich auch in der Liturgie (z. B. bei Rorate-Gottesdiensten) eingesetzt.
Die Untertasten sind aus Buchsbaum gefertigt, die Obertasten aus Ebenholz. Der Windruck der Orgel beträgt 76 mmWS; der Tremulant befindet sich im Windkanal.
Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Empore
Erbauer: Hans Mauracher - Salzburg (A) Baujahr: 1900 Umbauten: 1990, Christian Erler - Schlitters im Zillertal, Tirol (A) Restauriert: 2005, Wolfgang Bodem - Leopoldsdorf bei Wien (A) Standort: 1900-1990, mittlerer Brückenchor (Lettner); 1990, Transferierung auf die rückwärtige Empore Instrument: 22-registrige zweimanualige pneumatische Orgelmit zwei Prospektfronten, freistehender Spieltisch Spieltraktur: pneumatisch (mit Hängeventilladen) Registratur: pneumatisch, kleine Tastenschalter
1861 baute Josef Unterberger aus Innsbruck / Wörgl auf dem Brückenchor (Lettner) eine neue zweimanualige mechanische Orgel mit Kegelladen und zwei Prospektfronten: es handelte sich dabei um das erste in Tirol aufgestellte Instrument mit Kegelladen. Sehr wahrscheinlich war die Prospektfront Richtung Hochaltar eine Attrappe, da die Orgel ursprünglich nur eine Prospektfront besaß. 1877 führte Josef Sies aus Bozen Umbauarbeiten an der Orgel durch, dabei baute er u. a. sechs neue Zusatzregister in die Orgel ein.
1898 wurde die Orgel nach Besichtigung durch ein Fachgremium als nicht erhaltenswert befunden. Den Auftrag zum Neubauerhielt der Salzburger k. u. k. Hoforgelbauer Hans Mauracher, der 1900 auf dem Brückenchor (Lettner) der Hofkirche eine neue zweimanualige pneumatische 22-registrige Orgel mit zwei Prospektfronten aufstellte. Es war die erste in Innsbruckaufgestellte pneumatische Orgel.
1990 erfolgte die Versetzung der Orgel auf die Nordempore von Christian Erler aus Schlitters im Zillertal; das Instrumentwurde dabei um 180° gedreht und der Spieltisch, zuvor an der Gehäuserückseite (Altarseite), auf die Vorderseite versetzt.
2004-05 führte Wolfgang Bodem aus Wien eine umfangreiche Restaurierung durch, dabei rekonstruierte er den 1990 entfernten Magazinbalg mit zwei Schöpfbälgen sowie die fehlenden Pfeifen der Superoktavkoppel (für Trompete, Rausch-Quinte und Mixtur).
In der Mauracher-Orgel durften 1918 aus klanglichen Gründen die Prospektpfeifen verbleiben: da das Instrument weitgehend original erhalten ist, gilt es mittlerweile als ein wichtiges Klangdenkmal.
Hofkirche - Silberne Kapelle
Erbauer: italienischer Orgelbauer - (I) Baujahr: ca. 1580 Restauriert: 1949-1952, Hubert Neumann- Götzis, Vorarlberg (A); 1990-1993, Pier Paolo Donati- Florenz (I); 1998, Jürgen Ahrend- Leer, Friesland (D) Standort: bis 1721 Silberne Kapelle, rechts am Gitter; ab 1721 Silberne Kapelle, vordere Nische links; 1944 Abbau/Einlagerung in Schloss Tratzberg; 1946 Rückführung der Orgelteile nach Innsbruck Instrument: 7-registrige einmanualige Orgel mit Flügeltüren und angehängtem Pedal Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerschieber aus Nußholz
Die Silberne Kapelle wurde von 1578 bis 1596 als Grabkirche für Erzherzog Ferdinand II. und seine bürgerliche Gemahlin Philippine Welser aus Augsburg von Baumeister Hans Lucchese im Stil der Spätgotik und Renaissance erbaut. Ihren Namen verdankt die Silberne Kapelle dem Altar mit der silbernen Madonna, welchen der Innsbrucker Goldschmied Anton Ort schuf. Die Kapelle besitzt einen ganz besonderen Schatz: eine italienische Renaissance-Orgel aus dem späten 16. Jahrhundert, geschaffen von einem unbekannten italienischen Orgelbauer. Sie ist eine der bedeutendsten historischen Orgeln Österreichs! Die Bauweise des Instruments und die Bauart der aus Zypressenholz gefertigten quadratischen dünnwandigen Holzpfeifen verweisen eindeutig auf einen italienischen Orgelbauer.
1698 erfolgte die erste schriftlich dokumentierte Reparatur: Johann Caspar Humpel arbeitete dabei acht Wochen lang am Instrument und baute dort möglicherweise das Pedalregister Portuna ein. 1748 führte Ignaz Franz Wörle aus Bozen eine Reparatur durch. 1855 arbeitete der Innsbrucker Klavier- und Orgelbauer Joseph Morherr am Instrument. In den darauffolgenden Jahrzehnten verschlechterte sich der Zustand der Orgel zunehmend; Anfang des 20. Jahrhundert war sie unspielbar.
Im Februar 1944 erfolgte der Orgelabbau und die Transferierung der Orgelteile nach Schloss Tratzberg in Tirol von Wilhelm Zika jun. aus Ottensheim und Franz (IV) Reinisch aus Steinach a. Br. in Tirol. 1946 wurden die Orgelteile wieder nach Innsbruck gebracht und in der Nähe der Silbernen Kapelle gelagert.
Von 1949 bis 1952 erfolgte von Hubert Neumann aus Götzis in Vorarlberg eine Wiederherstellung und Restaurierung der Orgel. Bei der Rekonstruktion der fehlenden Holzpfeifen /-teile musste auf Lärche ausgewichen werden, da Zedern- und Zypressenholz damals nicht zu beschaffen war. Beim Pedal fehlten die Pfeifen des Registers Portuna 16‘, Neumann baute stattdessen - nach Vorgabe des damaligen Sachverständigen Egon Krauss aus Wien - einen offenen Octavbass 8‘ ein. 1955 erhielt die Orgel einen Elektromotor, was Stimmungsprobleme zur Folge hatte.
1990-93 führte Pier-Paolo Donati aus Florenz eine erneute Restaurierung durch: Er versuchte dabei, sich bestmöglich an den ursprünglichen Zustand der Orgel anzunähern (dabei wurde u. a. der Octavbass 8‘ wieder entfernt, das Pedal ist seither nur angehängt).
1997 wurde die Orgel, nachdem sie durch eine naheliegende Baustelle erheblich verschmutzt worden war, von Jürgen Ahrend aus Leer in Friesland gesäubert und die dabei noch bestehenden Intonationsschwächen beseitigt. Die Orgel ist mitteltönig gestimmt, die Stimmtonhöhe liegt um ca. einen Ganzton höher. Die Untertasten sind aus Elfenbein gefertigt, die Obertasten mit einem harten Tropenholz (vermutlich Schlangenholz) furniert. Der Windruck beträgt 48 mmWS.
Hofburg-Kapelle - Kaiserliche Hofburg Innsbruck
Erbauer: Mathias (II) Mauracher - Zell am Ziller (A) Baujahr: 1857 Restauriert: 2017, Alois Linder- Nußdorf am Inn (A) Standort: Hofburg-Kapelle, Empore Instrument: 6-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel mit Pedal Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerhebel
Die kaiserliche Hofburg Innsbruck, ursprünglich eine Burganlage aus dem Spätmittelalter, wurde bereits unter Kaiser Maximilian I. zu ihrer heutigen Größe als seine Residenz ausgebaut und 1500 fertiggestellt. Ihr heutiges Erscheinungsbild mit ihrer Rokokofassade, Hofkapelle und ihren Prunkräumen verdankt die Hofburg der Kaiserin Maria Theresia, die Umbauarbeiten erfolgten in zwei Etappen: von 1754 bis 1756 und nach dem Siebenjährigen Krieg, von 1765 bis 1770. Nach dem plötzlichen Tod von Kaiser Franz Stephan im Jahr 1765 (bei einer Hochzeitsfeier in Innsbruck), ließ seine Frau Kaiserin Maria Theresia die Hofburg zu einer Gedenkstätte ihres Mannes umgestalten und das Sterbezimmer ihres Mannes zur Hofburg-Kapelle umbauen.
1857 baute Mathias (II) Mauracher aus dem Zillertal eine neue einmanualige mechanische Orgel auf die Empore der Kapelle. Nach Fertigstellung der Orgel erfolgte die Kollaudierung am 2.6.1857. Während der beiden Weltkriege blieben die originalen Prospektpfeifen glücklicherweise erhalten. Die Spielanlage der Orgel befindet sich seitlich. Das Instrument besitzt einen Elektromotor mit einem einfaltigen Keilbalg, welcher früher von Hand betätigt wurde.
1960 erfolgte im Rahmen einer Restaurierung auch ein Neubau des Orgelgehäuses nach einem Entwurf des damaligen Schlossverwalters Hubert Kittinger. Die Steinacher Orgelbaufirma Karl Reinisch‘s Erben baute damals einen Elektromotor für die Windversorgung ein und fertigte neue Registerschilder an. Bereits 1965 führte Arnulf Kleber aus Wien zwecks Verringerung der Mechanikgeräusche eine weitere Restaurierung durch.
Bei der letzten Restaurierung, durchgeführt 2017 von Orgelbau Linder aus Nußdorf am Inn, wurden die bei der vorherigen Restaurierung eingebauten Kunststoffteile wieder entfernt, die Trakturgeräusche durch Lederschlaufen gemildert und das bestehende Pfeifenwerk sorgfältig restauriert. Linder baute dabei auch einen neuen Elektromotor in einem schallgedämmten Kasten im Raum hinter der Orgel ein.
Jesuitenkirche - Universitätskirche, 2. Empore
Erbauer: E. F. Walcker & Cie - Ludwigsburg, Stuttgart (D) Baujahr: 1959 Standort: 2. Nordempore Instrument: 32-registrige dreimanualige Schleifladenorgel, Spielschrank (derzeit Türen ausgehängt) Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Das erste Jesuitenkolleg mit Gymnasium wurde bereits 1562 eröffnet; der Bau der heutigen Jesuitenkirche erfolgte 1900-01. 1878 bauten die Gebr. Rieger aus Jägerndorf (heute Tschechien) noch in der Vorgängerkirche eine neue 16-registrige zweimanualige mechanische Orgel.
1932 stellten die Gebrüder Mauracher aus Zell im Zillertal eine neue zweimanualige 25-registrige pneumatische Orgel auf. 1939 wurde das Jesuitenkolleg enteignet und als Polizeidirektion genutzt; die Rückgabe an die im Zuge der Enteignung vertriebenen Jesuiten erfolgte erst 1945. 1943 zerstörte eine Sprengbombe die Kuppel der Kirche sowie die Apsis (mit dem wertvollen Hochaltar), u. a. auch die Mauracher-Orgel.
Nach Wiederherstellung der Kirche (1946-1953) sollte eigentlich Orgelbauer Wilhelm Zika aus Oberösterreich eine neue mechanische Orgel mit Flügeltüren errichten. Da sich jedoch der Baubeginn bei ihm wegen eines anderen Orgelbauprojektes immer wieder verzögerte, erhielt schließlich die deutsche Orgelbaufirma E. F. Walcker & Cie aus Ludwigsburg den Auftrag zum Orgelneubau.
1959 errichtete Walcker auf die zweite Empore der Jesuitenkirche eine dreimanualige 33-registrige rein mechanische Schleifladenorgel. Die Disposition erstellte Prof. Anton Heiller aus Wien. Von 2007 bis 2011 wurde das Instrument im Zuge einer Generalsanierung durch Rösel & Hercher Orgelbau aus Saalfeld an der Saale in Thüringen restauriert. Dabei wurden in die Orgel auch zusätzlich die beiden Register Schalmey 8‘ und Cornett sowie die Tremulanten eingebaut.
Jesuitenkirche - Universitätskirche, mobil
Erbauer: Giovanni Pradella - Veltlin, Sondrio (I) Baujahr: 2020 Standort: Langhaus Instrument: 5-registrige einmanualige Truhenorgel, mit einer ins Gehäuse versenkbaren Tastatur Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Bei der 5-registrigen einmanualigen Truhenorgel, erbaut 2020 vom italienischen Orgelbauer Giovanni Pradella aus dem Veltlin bei Sondrio, handelt es sich um eine Gemeinschaftsanschaffung des Innsbrucker Jesuitenkollegs, der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik und des Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.
Der Standort der transportablen Truhenorgel ist grundsätzlich der Kirchenraum der Jesuitenkirche. Die Register Principale 8‘, Flauto 4‘ und Regale 8‘ sind in Bass (Bassi) und Diskant (soprani) geteilt. Das Gehäuse besteht aus massivem Eichenholz. Die Untertasten sind aus Buchsbaumholz gefertigt, die Obertasten aus Ebenholz.
Die Truhenorgel besitzt je zwei Haltegriffe aus Eisen für Transportzwecke. Die ins Gehäuse versenkbare Tastatur kann viermal um je einen Halbton verschoben werden: a1 = 390 Hz. / a1 = 415 Hz. / a1 = 440 Hz. / a1 = 465 Hz. Das Instrument besitzt einen Magazinbalg, welcher von einem Elektromotor gespeist wird.
Innsbrucker Jesuitenkolleg - Hauskapelle
Erbauer: Reinisch Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr ca. 1960-70 Standort: bis 1994 Leihorgel; 1994-2019 Hauskapelle Canisianum; seit 2019 Hauskapelle Innsbrucker Jesuitenkolleg Instrument: 5-registriges einmanualiges mechanisches Schleifladen-Orgelpositiv, Spielkasten Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
In der Hauskapelle des Innsbrucker Jesuitenkollegs befindet sich ein bemerkenswertes Apsis-Mosaik, geschaffen von dem in Schwaz geborenen Jugendstilmaler Emanuel Raffeiner und ausgeführt 1914 von der Tiroler Glasmalerei- und Mosaikanstalt. Die seitlich im Kirchenraum stehende 5-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel mit angehängtem Pedal baute die Steinacher Orgelbauwerkstatt Reinisch-Pirchner in den 1960er Jahren ursprünglich als Leihorgel. Das asymmetrische Orgelgehäuse besteht aus massivem Fichtenholz; die Untertasten sind aus Buchsbaum, die Obertasten aus Ebenholz gefertigt. Aus unbekannten Gründen verzichtete Johann Pirchner bei der oberhalb der Tastatur angebrachten Firmenplakette auf den Vermerk des Baujahres.
1994 wurde die Leihorgel in der Hauskapelle des Canisianums aufgestellt. Nachdem man dort mit dem Instrument sehrzufrieden war, wurde sie vom Canisianum noch im gleichen Jahr angekauft.
2013 übersiedelte das Theologenkonvikt wieder ins Gebäude des Jesuitenkollegs in der Sillgasse; das Canisianum (Gebäude)beherbergt mittlerweile ein Studentenheim der Akademikerhilfe.
2019 transferierte der Steinacher Orgelbauer Martin Pirchner das Reinisch-Pirchner-Instrument von der Hauskapelle im Canisianum in die Hauskapelle des Innsbrucker Jesuitenkollegs.
Kapuzinerkirche
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1986 Standort: Westempore Instrument: 7-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
1585 kamen auf Betreiben des damaligen Landesfürsten Erzherzog Ferdinand II. und seiner zweiten Gemahlin Anna Katharina von Gonzaga erste Kapuziner als Fastenprediger an den Innsbrucker Hof. 1593 erfolgte die Grundsteinlegung für den ersten Klosterbau, die Einweihung der Klosterkirche fand bereits im darauffolgenden Jahr am 18.12.1594 durch den Brixner Weihbischof Georg Benigni statt. Das Innsbrucker Kapuzinerkloster ist das älteste Kloster des Kapuzinerordens in Deutschland, Österreich und Südtirol.
Während der Regierungszeit von Kaiser Joseph II. war das Kloster von 1787 bis 1802 aufgehoben. 1940 wurde das Kapuzinerkloster von den Nationalsozialisten erneut aufgehoben und als militärisches Lager verwendet, konnte jedoch nach Ende des II. Weltkriegs 1945 wiedereröffnet werden. Von 1991 bis 1994 erfolgte eine Generalsanierung der Klosteranlage.
Vor 1986 gab es in der Kirche nur ein zweimanualiges Harmonium; 1986 errichtete die Steinacher Orgelbaufirma Reinisch-Pirchner auf der Westempore der Klosterkirche eine neue 7-registrige einmanualige Schleifladenorgel mit Pedal. Das Orgelgehäuse besteht aus massivem Eichenholz; die Untertasten der Manualklaviaturen sind aus Ebenholz gefertigt, die Obertasten mit Knochen belegt.
Tiroler Landeskonservatorium
Erbauer: Henk Klop - Garderen, Gelderland (NL) Baujahr: 1995 Standort: Raum U13A (Musikzimmer für Alte Musik) Instrument: 4-registrige einmanualige mechanische Truhenorgel, mit ins Gehäuse versenkbarer Tastatur Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Das Tiroler Landeskonservatorium ging aus der Musikschule Innsbruck hervor, welche bereits 1818 vom damals neu gegründeten Innsbrucker Musikverein eingerichtet worden war. Anfangs wurde in diversen Räumlichkeiten unterrichtet; ab 1912 erfolgte der gesamte Unterricht in einem neu gebauten Musikschulgebäude, dem heutigen Tiroler Landeskonservatorium. 1934 wurde die Musikschule in ein Konservatorium umgewandelt.
1987 erfolgte die Trennung von Konservatorium und Musikschule: das Konservatorium verblieb in der Paul-Hofhaimer-Gasse, die Musikschule übersiedelte vollständig in die Räumlichkeiten des ehemaligen Ursulinenklosters.
1995 kaufte das Tiroler Landeskonservatorium das 4-registrige Orgel-Truhenpositiv von der niederländischen Orgelbaufirma Henk Klop aus Garderen.
Das Instrument besitzt ein massives Eichengehäuse, Schleierbretter mit barocken Blumenmotiven, geteilte Register, hat nur Holzpfeifen und an beiden Seiten je zwei versenkbare Haltegriffe. Die Untertasten der Klaviatur sind mit Ebenholz belegt, die Obertasten mit Ahorn. Die Windanlage der Orgel befindet sich im Gehäuse, der Winddruck beträgt 50 mmWS. Die Truhenorgel lässt sich durch Tastaturverschiebung auf drei verschiedenen Tonhöhen spielen: a1 = 415 Hz / 440 Hz / 465 Hz.
Das Instrument befindet sich im Musikzimmer für Alte Musik (im Erdgeschoß des Gebäudes) und wird bei den diversen Ensembleproben und Konzerten im Konservatorium verwendet.
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 16
Erbauer: unbekannt Baujahr: undatiert (ca. 1650-80) Standort: Musiksammlung Instrument: 1-registriges Regal mit kurzer Bassoktav und zwei aufziehbaren 6-fältigen Keilbälgen Spieltraktur: mechanisch Registratur: nicht vorhanden
Das 1-registrige Instrument wurde Mitte 17. Jahrhundert gebaut: die Beschriftungen auf den Zungenpfeifen weisen auf eine Nähe zur Werkstatt des Innsbrucker Hoforgelmachers Daniel Herz hin.
Das kompakte Gehäuse besteht aus massivem Eichenholz. Die Untertasten sind aus Buchsbaum, die Obertasten aus gefärbtem Obstbaumholz gefertigt. Bei den Regal-Zungenpfeifen handelt es sich um Pfeifen aus Zinn mit Messingkehlen und rechteckigen Schallresonatoren mit Austrittsöffnungen in den Deckeln. Der Zungenpfeifen-Raum ist zweifach abgedeckt: mit einem Schnitzgitter und mit einem geschlossenen Deckel zwecks Musizieren mit unterschiedlichen Lautstärken. Die Windversorgung erfolgt mittels zwei aufziehbaren 6-faltigen Keilbälgen.
Auf den Pfeifen befinden sich Tonbuchstaben in deutscher Kurrentschrift, die deutliche Ähnlichkeiten mit Beschriftungen von Daniel Herz, aufweisen. Auch die Haltegriffe zum Aufziehen der beiden jeweils 6-faltigen Keilbälge haben Ähnlichkeiten mit den charakteristischen Registerzügen von Daniel Herz.2020 erfolgte die letzte Restaurierung durch den Restaurator Friedemann Seitz aus Süddeutschland, dabei wurden auch neue Gewichte für die Keilbälge gefertigt.
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 267
Erbauer: Joseph Antoni Simnacher (?) - Brixen, Südtirol (I) Baujahr: undatiert (ca. 1760-80) Standort: Musiksammlung Instrument: 2-registriges Orgelpositiv mit kurzer Bassoktav, Flügeltüren und vorgebautem Spielapparat Spieltraktur: mechanisch Registratur: verschiebbare Registerhebel
Das 2-registrige Schrank-Orgelpositiv wurde wahrscheinlich in der Zeit von 1760 bis 1780 vom in Brixen ansässigen Orgelmacher Joseph Antoni Simnacher gebaut (Die Machart der Tastatur und der Registerhebel ist gleich wie bei der von Simnacher gebauten Orgel in der Kirche zum Hl. Nikolaus in Petschied in Hinterlüsen bei Brixen.).
Das Instrument verfügt über zwei Register. In den beiden seitlichen Pfeifenfeldern der Vorderseite befinden sich je 12 MetallProspektpfeifen, im mittleren Pfeifenfeld stehen nochmals 18 Metallpfeifen. Die restlichen Pfeifen sind aus Holz gefertigt. Die Klaviatur hat eine kurze Bassoktav, links davon befinden sich die horizontal verschiebbaren Registerhebel. Die Untertasten sind aus Buchsbaum, die Obertasten aus gefärbtem Obstbaumholz gefertigt.
An der Vorderseite des aus Fichtenholz gebauten Orgelgehäuses sind verschließbare Flügeltüren angebracht. An den beiden Seitenfronten befinden sich zentral im Unterbau des Gehäuses je eine Seil-Halteschlaufe für den Transport. Der Schöpfbalg - zu betätigen mit einem seitlichen Fußhebel - wurde wahrscheinlich später hinzugefügt; beim Treten befüllt er den darüber liegenden 4-faltigen Keilbalg.
Eine Besonderheit ist der vor der Tastatur platzierte Spielapparat mit Kurbelbetätigung und zwei Spielwalzen: Damit können bei Kurbelbetätigung sieben bzw. acht Musikstückchen wiedergegeben werden.
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 87
Erbauer: unbekannt - aus Mirecourt, Grand Est (F) Baujahr: unbekannt (1750-1800) Standort: Musiksammlung Instrument: 2-registrige Serinette / Vogel-Orgel Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge seitlich links
Bei der Vogel-Orgel, französisch Serinette genannt, handelt es sich um ein heute fast vergessenes Musikinstrument, einen sehr kleinen mechanischen Musikautomaten. Ursprünglich (im 18. Jahrhundert) wurden diese kleinen Drehorgeln gebaut, um Singvögeln, welche in Käfigen gehalten wurden, Melodien beizubringen. Im 19. Jahrhundert dienten sie oft auch zur Unterhaltung (u. a. für Kinder).
1910 wurde diese Serinette vom Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Tarrenz bei Imst in Tirol angekauft. Sie besitzt zwei Register mit je 9 Pfeifen aus Holz. Durch den Handbetrieb einer Kurbel wird ein Blasbalg aufgezogen sowie eine Walze mit darauf montierten Metallstiften gedreht, welche in einer bestimmten Abfolge Ventile bewegen und dadurch Töne bzw. Melodien erzeugen.
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 166
Erbauer: Frédéric Clément - Mirecourt, Grand Est (F) Baujahr: unbekannt (1850-1900) Standort: Musiksammlung Instrument: 1-registrige Serinette / Vogel-Orgel Spieltraktur: mechanisch Registratur: nicht vorhanden
Die Serinette, auch Vogel-Orgel genannt, wurde in einem Zeitraum von 1850 bis 1900 von Frederic Clément aus Mirecourt in Frankreich erbaut. Sie besitzt nur eine Pfeifenreihe aus Metall (mit vermutlich hohem Bleianteil).Das Gehäuse aus Nussholz kann über einen aufklappbaren Deckel geöffnet werden. Auf dessen Innenseite klebt ein bedruckter Zettel mit den Liedernamen der spielbaren Stücke. An der rechten Seite befindet sich ein verschiebbarer Dorn zur Liederwahl.
Gleich wie bei der im Museum auch vorhandenen 2-registrigen Serinette wird durch den Handbetrieb einer Kurbel ein Blasbalg aufgezogen sowie eine Walze mit darauf montierten Metallstiften gedreht, welche in einer bestimmten Abfolge Ventile bewegen und dadurch Töne bzw. Melodien erzeugen.
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 551
Erbauer: Herbert Kuen - Götzens, Tirol (A) Baujahr: 1983 Standort: Musiksammlung Instrument: 1-registriges Regal mit kurzer Bassoktav und zwei aufziehbaren 6-faltigen Keilbälgen Spieltraktur: mechanisch Registratur: nicht vorhanden
1983 baute der Tiroler Instrumentenbauer Herbert Kuen, damals in Neu-Rum ansässig, ein 1-registriges Regal mit kurzerBassoktav. Beim Instrument handelt es sich um einen exakten Nachbau eines Regals von Michael Klotz, erbaut Ende des 16.Jahrhunderts, das im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg ausgestellt ist. Im Gegensatz zum Original ist der Nachbau nicht bemalt. Das Gehäuse besteht aus Fichte / Ahorn, die Bälge aus Fichte mit Eichen-Balgfalten. Die Pfeifen baute Kuen aus Messing. Die Untertasten sind aus Birne, die Obertasten aus dunkel gefärbter Eiche gefertigt. 2024 übergab Herbert Kuen, mittlerweile in Götzens ansässig, das Regal als Schenkung dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum für dessen Musiksammlung.
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 554
Erbauer: Herbert Kuen - Götzens, Tirol (A) Baujahr: 2022-24 Standort: Musiksammlung Instrument: 3-registriges zweimanualiges mechanisches Claviorganum Spieltraktur. mechanisch Registratur: Registerhebel
Der Tiroler Instrumentenbauer Herbert Kuen baute von 2022 bis 2024 ein sogenanntes Claviorganum, ein Instrument gemischt mit Saiten und Pfeifen, bestehend aus einem Cembalo und einer Orgel.
Beim Cembalo, das er bereits 2011 in Götzens geschaffen hatte, handelt es sich um einen Nachbau eines Cembalos von Dominicus Pisaurensis von 1533, das im Musikinstrumentenmuseum Leipzig ausgestellt ist. Im Gegensatz zum Original besitzt der Nachbau keine kurze Bassoktav, sondern ist in der untersten Oktav voll ausgebaut. Der Korpus besteht aus dünnwandigem (3-4 mm) sichtbaren Fichtenholz. Die Saiten sind im Diskantbereich aus halbhartem Eisen, im Bassbereich aus Messing gefertigt. Die Untertasten baute Kuen aus Buchsbaum, die Obertasten aus Nussholz.
2023-24 verwendete er das oben beschriebene Cembalo (op. 27), um daraus ein Claviorganum (Nr. 40) zu bauen. Das Orgelpositiv verfügt über zwei Register: - Regal 8‘ mit Holzkehlen und jeweiliger Nuss aus Ahorn sowie Resonatoren aus Zypressenholz, - Flöte 4‘ aus Fichtenholz, im Bassbereich gedeckt mit Deckeln aus Ahorn, im Diskant ab g0 offen und auf Länge geschnitten.
Die Untertasten baute Kuen aus Buchsbaum, die Obertasten aus Zwetschgenholz. Das II. Manual ist an das darunterliegende(Cembalo)-Manual koppelbar. 2024 übergab Herbert Kuen das Claviorganum als Schenkung dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum für dessen Musiksammlung.
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 337
Erbauer: Reinisch Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1996 Standort: Musiksammlung Instrument: 3-registrige einmanualige mechanische Schleifladen-Truhenorgel Spieltraktur: Stechermechanik Registratur: mechanisch, verschiebbare Registerhebel
1996 baute Orgelbauer Johann Pirchner aus Steinach am Brenner eine 3-registrige mechanische Schleifladen-Truhenorgel mit massivem Kirschholz-Gehäuse und verschließbaren Flügeltüren. Die Untertasten sind mit Grenadillholz belegt, die Obertasten aus Ahorn mit Knochenauflage gefertigt. Im Unterbau befindet sich der Elektromotor und ein einfaltiger Keilbalg.
Die Tastatur kann um einen Halbton nach links verschoben werden: 1.) a1 = 440 Hz. 2.) a1 = 415 Hz. Die Ausgangsstimmung des Instruments ist gleichschwebend.
Chorverband Tirol - Haus der Musik, Leihorgel
Erbauer: Henk Klop - Garderen, Gelderland (NL) Baujahr: 2014 Standort: Büro des Chorverband Tirols Instrument: 2-registrige einmanualige mechanische Truhenorgel, mit ins Gehäuse versenkbarer Tastatur Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Das zweiregistrige Orgel-Truhenpositiv mit geteilten Registern wurde 2014 von der Orgelbaufirma Henk Klop aus Garderen in den Niederlanden für den Chorverein Tirol (Tiroler Sängerbund) gebaut. Das Instrument hat ein massives Eichengehäuse, Schleierbretter mit barocken Blumenmotiven und besitzt nur Holzpfeifen aus Zedernholz und Birne. Die Untertasten der Klaviatur sind mit Ebenholz belegt, die Obertasten mit Ahorn. Die Windanlage der Orgel befindet sich im Gehäuse, der Winddruck beträgt 50 mm WS (Wassersäule).
Das Instrument kann auf drei verschiedenen Tonhöhen gespielt werden (durch Verschieben der Tastatur): Position 1 - Tastatur links, a1 = 415 Hz (Bass-/Diskantteilung: c1/cis1) Position 2 - Tastatur Mitte, a1 = 440 Hz (Bass-/Diskantteilung: h0/c1) Position 3 - Tastatur rechts, a1 = 465 Hz (Bass-/Diskantteilung: b0/h1)
Das Instrument ist leicht und sehr kompakt gebaut und hat zum Tragen an den beiden Seiten je zwei versenkbare Haltegriffe eingebaut. Es kann von Chorformationen, Gesangs-/ und Instrumentalensembles oder auch Konzertveranstaltern gegen eine Leihgebühr ausgeliehen werden. Für den Transport stehen ein Schutzkoffer und ein Rollwagen zur Verfügung.
Kontaktinfo: Haus der Musik, Büro des Chorverband Tirols Universitätsstraße 1, 6020 INNSBRUCK Telefon: +43 (0)512 588801 E-Mail: sekretariat@chorverband.tirol
Congress Innsbruck - Saal Tirol
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1975 Standort: Saal Tirol, rechte vordere Ecke der Bühne Instrument: 31-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank mit Türen Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Das Kongresshaus, heute von den Inhabern unter der Bezeichnung „Congress Innsbruck“ vermarktet, wurde 1973 an der Stelle des im 2. Weltkrieg zerstörten Gebäudes „Dogana“ erbaut.
Im größten Saal, dem Saal Tirol, war ursprünglich kein Instrument geplant: die zweimanualige, mechanisch konzipierte Schleifladen-Orgel mit Pedal wurde 1975 von der Orgelbaufirma Reinisch-Pirchner aus Steinach am Brenner in der rechten vorderen Ecke des als Mehrzweckraum geplanten Saals platziert.
Das Instrument kann hinter einer verschiebbaren Wand unsichtbar gemacht werden. Der exzentrische Bauplatz und die im gesamten Saal mit Kunstholz ausgestatteten Oberflächen bewirken eine nicht optimale Klangentfaltung im Saal und eine trockene Akustik (dies wurde auch nach dem Einweihungskonzert in den Salzburger Nachrichten vom 5.1.1976 vermerkt). Die Disposition erstellten Prof. Karl Benesch und Prof. Kurt Neuhauser.
Spitalskirche
Erbauer: Johann Georg Gröber - Innsbruck, Tirol (A) Baujahr: 1846 Umbau: 1963, Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Standort: 2. Nordempore Instrument: 13-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Bereits seit 1326 ist in Innsbruck ein Stadtspital dokumentiert; die erste schriftliche Erwähnung einer Spitalskirche stammt aus dem Jahr 1389. 1888 erfolgte die Verlegung des Spitals an die Stelle der heutigen Universitätsklinik. 1689 wurde die damalige gotische Spitalskirche bei einem Erdbeben stark beschädigt, 1700 dann bis auf die Grundmauern abgerissen. Die neue Kirche, eingeweiht 1705, entstand nach Plänen des Innsbrucker Hofbaumeisters Johann Martin Gumpp dem Älteren.
1708 baute der Innsbrucker Orgelmacher Simon Pfurtscheller eine neue Barock-Orgel, sie musste 1764 einem Neubau von Andreas Jäger aus Füssen weichen. 1829 errichtete Joseph Schmid, ein autodidaktischer Orgelbauer aus Hall in Tirol, ein neues Instrument.
Anscheinend war dieser Neubau nicht sehr gelungen, weswegen das Instrument bereits 1846 durch eine neue 11-registrige Orgel des Innsbrucker Orgelbauers Johann Georg Gröber ersetzt wurde.
Im Zuge einer Kirchenrestaurierung wurde 1963 das Orgelwerk von der Steinacher Orgelbauwerkstatt Reinisch-Pirchner komplett überarbeitet, auf 13 Register erweitert, das 12-Töne-Pedal mit einer 27-Tastenklaviatur versehen (dessen 12 Töne repetitieren) und statt der bisherigen zentralen Spielanlage vor der Orgel eine neue seitliche Spielanlage mit verschließbaren Schranktüren gebaut.
Servitenkirche
Erbauer: E. F. Walcker & Cie - Ludwigsburg, Stuttgart (D) Baujahr: 1975-76 Standort: Nordempore Instrument: 20-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Das Kloster der Serviten, gegründet und erbaut von 1614 bis 1616, wurde von der Witwe Erzherzog Ferdindands II., Anna Katharina Gonzaga von Mantua gestiftet, brannte aber bereits 1620 ab. Die wieder aufgebaute Kirche wurde 1626 dem Hl. Josef geweiht.
Bereits aus dem Jahre 1750 ist eine Orgelreparatur vom Trientner Orgelbauer Giuseppe Reina überliefert. 1760 errichtete der aus Füssen stammende Orgelbauer Andreas Jäger eine zweimanualige 16-registrige Orgel mit Pedal.1891 erfolgte ein Neubau von Anton Behmann aus Schwarzach in Vorarlberg: ein zweimanualiges 13-registriges Instrument mit Kegelladen in einem Neu-Renaissance-Gehäuse. 1902 baute die Orgelbaufirma Weigle aus Stuttgart-Echterdingen zwei Hochdruckregister in die Orgel dazu.
Am 3.11.1938 wurde das Kloster vom nationalsozialistischen Regime als erstes Kloster in Innsbruck aufgehoben. Die Mönche mussten innerhalb von zwei Tagen das Kloster verlassen, Beamte des NS-Regimes zogen in die Räumlichkeiten ein. Am 15. Dezember 1943 erlitt das Gebäude so schwere Bombenschäden, dass es 1944 abgebrochen wurde.
Nach Ende des Krieges bezogen bereits 1945 einige Serviten-Mönche die Ruine und bauten Kloster und Kirche wieder auf.1947 wurde die Innenstadtpfarrei St. Josef geschaffen. 1975-76 baute die Firma E. F. Walcker & Cie aus Ludwigsburg eine neue zweimanualige mechanische 20-registrige Schleifladenorgel mit einer horizontalen Hauptwerkstrompete 8‘ ober der zentralen Spielanlage in der Prospektfront.
Landhauskapelle - Altes Landhaus
Erbauer: Orgelbau Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 2010 Standort: Westempore Instrument: 10-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel mit Pedal, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Im Zuge des Landhaus-Neubaus wurde 1730 die Landhauskapelle zu Ehren des Tiroler Landespatrons, dem Hl. Georg, von Georg Anton Gumpp errichtet. Im Landhaus, einem barocken Prunkbau, finden seit Einführung des Parteiensystems die Landtagsitzungen statt. In der Kapelle werden nach wie vor Gottesdienste gefeiert.
2010 baute Orgelbau Pirchner aus Steinach am Brenner eine neue Orgel auf der Empore der Kapelle. Er verwendete dabei Gehäuseteile einer alten einmanualigen 11-registrigen Orgel aus Kirchberg in Tirol, erbaut 1825-26 von Karl Mauracher aus Fügen im Zillertal.
Pirchner baute das Instrument historisierend und orientierte sich am süddeutschen Instrumentenbau um 1725: Er fertigte u.a. geschmiedete Nägel und Schrauben, gespundete Windladen und zwei Keilbälge für die Windversorgung. Die Orgel besitzt kurze Bassoktav und zwei Doppel-Obertasten (D/Fis und E/Gis).
Musikschule der Stadt Innsbruck - Reinhard Jaud Saal
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1977 Standort: Reinhard Jaud Saal (4. Stock) Instrument: 9-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Im Jahre 1818 wurde der Innsbrucker Musikverein gegründet und von ihm eine erste Musikschule in Innsbruck eingerichtet. Anfangs war der Unterricht auf verschiedene und wechselnde Räumlichkeiten bzw. Gebäude verteilt. Nach Fertigstellung des neu errichteten Musikschulgebäudes, dem heutigen Tiroler Landeskonservatorium in der Paul-Hofhaimer-Gasse 6, erfolgte dort ab 1912 die Durchführung und Abwicklung des gesamten Unterrichts.
Aufgrund zunehmender Platzprobleme mietete die Musikschule in den 1980er Jahren Räumlichkeiten des ehemaligen Ursulinenklosters für Unterrichtszwecke dazu.
1987 erfolgte die Trennung von Konservatorium und Musikschule: die Musikschule übersiedelte vollständig in die Räumlichkeiten des ehemaligen Ursulinenklosters. Seither existiert die Musikschule der Stadt Innsbruck eigenständig und parallel zum Tiroler Landeskonservatorium. 2006 kaufte die Stadt Innsbruck das Musikschulgebäude von der Raiffeisenbank.
1977 baute Johann Pirchner aus Steinach am Brenner eine neue zweimanualige mechanische 9-registrige Unterrichtsorgel mit Pedal für das Tiroler Landeskonservatorium und stellte sie im dortigen Untergeschoß in einem Probenraum auf. Das Instrument besitzt ein Gehäuse mit verschließbaren Flügeltüren aus massivem Eichenholz. Die Untertasten sind aus Ebenholz gefertigt, die Obertasten mit Knochen belegt. Die Disposition stammt vom damaligen Domkapellmeister Prof. Michael Mayr.
Die Orgel gehört nach wie vor dem Tiroler Landeskonservatorium und wird zusammen mit der Musikschule der Stadt Innsbruck genutzt. Sie befindet sich derzeit im 4. Stock der Musikschule der Stadt Innsbruck im Reinhard Jaud Saal.
Musikschule der Stadt Innsbruck - Vortragssaal
Erbauer: Gebrüder Mayer Orgelbau - Feldkirch, Vorarlberg (A) Baujahr: 1989 Standort: 1989-2003 Karmel der Karmelitinnen; seit 2004 Vortragsaal Musikschule Innsbruck Instrument: 6-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Die einmanualige 6-registrige, mechanische Schleifladenorgel, mit freistehendem Subbass 16‘ hinter der Orgel, wurde 1989 von den Gebrüder Mayer Orgelbau aus Feldkirch in Vorarlberg für das Karmelitinnenkloster St. Josef in der Adamgasse in Innsbruck gebaut und dort in dem zentralen Gebetsraum des Klosters aufgestellt.
Das neobarock konzipierte Instrument war jedoch sehr obertonreich: nach dem Empfinden der Ordenschwestern hatte es zu laut klingende Register, welche sich nur bedingt für die Begleitung des Chorgebetes eigneten. 2003 zogen die Karmelitinnen ins neu gebaute Kloster in Mühlau um, wurde die Orgel an die Musikschule der Stadt Innsbruck verkauft und im dortigen Vortragsaal im 1. Stock platziert.
Das Mayer-Orgelgehäuse ist aus massivem Eichenholz gefertigt. Die Registerzüge sowie die Unter- und Obertasten der Klaviatur sind aus Ebenholz gebaut, wobei die Oberseite der Obertasten jeweils mit einer Einlage aus Knochen versehen sind.
Musikschule der Stadt Innsbruck - Ursulinensaal
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1990 Standort: 1990-2016 Vortragssaal (Abteilung X, Mozarteum); ab 2016 Ursulinensaal (Musikschule) Transferiert: 2016, Rösel - Saalfeld, Thüringen (D) Instrument: 7-registrige zweimanualige, mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Das Department für Musikpädagogik Innsbruck, eine Expositur der Universität Mozarteum Salzburg, ist zentrale Ausbildungsstätte für Musikpädagogen und Musikpädagoginnen in Westösterreich.
1990 errichtete die Steinacher Orgelbauwerkstatt Reinisch-Pirchner in einen Unterrichtsraum der Abteilung X eine neue 7- registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel mit Pedal. 2016, im Zuge des Mozarteum-Umzugs in das neu gebaute „Haus der Musik“, wurde das Instrument der Musikschule der Stadt Innsbruck zur Verfügung gestellt.
Im Auftrag der Musikschule der Stadt Innsbruck transferierte Orgelbauer Rösel aus Saalfeld in Thüringen noch im gleichen Jahr das Instrument auf ein zuvor neu errichtetes Podest im Bühnenbereich des Ursulinensaals, adaptierte es für den neuen Standort und führte außerdem eine Generalsäuberung und Neuintonation der Orgel durch.
Die Orgel besitzt ein Gehäuse mit verschließbaren Flügeltüren aus massivem Eichenholz. Die Untertasten der Manualklaviaturen sind mit Ebenholz belegt, die Obertasten mit Knochen.
BORG Innsbruck - Proben-/ Orchesterraum
Erbauer: Karl Reinisch‘s Erben - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1957-58 Standort: Proben-/ Orchesterraum (ehemalige Hauskapelle) Instrument: 14-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Das Bundesoberstufengymnasium BORG Innsbruck wurde 1766 in der Kuepachgasse 10 in der Altstadt als Normalhauptschule gegründet, in deren oberen Klassen die Lehrerausbildung erfolgte. 1869 erfolgte die Umwandlung zur k. k. Lehrerbildungsanstalt und Musterhauptschule zu Innsbruck (LBA).
Nachdem der Standort in der Altstadt allmählich zu klein wurde, übersiedelte die Schule 1877 in die größeren Räumlichkeiten des von 1874 bis 1877 neu gebauten Pädagogium - heute BORG Innsbruck - in der Fallmerayerstraße 7. 1963 wurde das Musisch-Pädagogische Bundes-Realgymnasium eröffnet; seit 1976 heißt die Schule „BORG Innsbruck“. 1902 stellte Orgelbauer Franz (II) Reinisch aus Steinach am Brenner im Festsaal der Schule eine erste, neue 7-registrige einmanualige, pneumatische Kegelladenorgel auf.
1957-58 errichtete die Steinacher Nachfolge-Orgelbaufirma Karl Reinisch‘s Erben im Orchesterraum des BORG Innsbruck (einst Hauskapelle der früheren Lehrerbildungsanstalt) eine 14-registrige, zweimanualige mechanische Schleifladenorgel mit Hauptwerk, Brustwerk (mit verschließbaren Flügeltüren) und Pedal. Die Disposition erstellte Prof. Alois Forer aus Wien. Das rein mechanische Instrument war damals wegweisend für die Weiterentwicklung des Orgelbaus in Tirol. Anlässlich der ersten Innsbrucker Orgelwoche im September 1958 stellte Prof. Anton Heiller aus Wien die Orgel der Öffentlichkeit in einem viel beachteten Konzert mit Werken von Johann Sebastian Bach vor.
BORG Innsbruck - Festsaal
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1966 Standort: Festsaal Instrument: 6-registriges einmanualiges mechanisches Schleifladen-Positiv mit Pedal, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
1902 errichtete die Steinacher Orgelbauwerkstatt Franz (II) Reinisch im Festsaal des BORG Innsbruck (früherLehrerbildungsanstalt) eine neue 7-registrige einmanualige, pneumatische Kegelladenorgel.
1966 baute dort die Steinacher Nachfolge-Orgelbaufirma Reinisch-Pirchner ein neues 6-registriges einmanualigesmechanisches Orgelpositiv mit Pedal.
Serbisch-Orthodoxe Kirche (ehemalig Herz Jesu Kirche)
Erbauer: Hans Mauracher - Salzburg (A) Baujahr: 1900 Restauriert: 1996, Windtner Orgelbau - Linz, Oberösterreich (A) Standort: Südempore Instrument: 16-registrige zweimanualige pneumatische Orgel mit Barkermaschine, freistehender Spieltisch Spieltraktur: pneumatisch (mit Hängeventilladen) Registratur: pneumatisch, kleine Tastenschalter
Die Ordensgemeinschaft der Redemptoristen, seit 1827 in Innsbruck ansässig, baute 1895 in der Nähe des neuen Innsbrucker Krankenhauses ein neues Kloster. 1896 wurde der Grundstein für die neu zu bauende Kirche gelegt, die Fertigstellung der nach Plänen des Innsbrucker Baumeisters Peter Huter errichteten neuromanischen Kirche erfolgte 1898. 1950 wurde die Kirche zur Pfarrkirche erhoben.
Aufgrund des Rückgangs seiner Mitglieder entschied der Redemptoristenorden 2018, Innsbruck zu verlassen und die Kirche der Serbisch-Orthodoxen Gemeinde als Schenkung zu übergeben. Die Übergabe erfolgte im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes am 9. März 2019. Der Kirchenbau steht mittlerweile unter Denkmalschutz.
1900 baute der Salzburger k. u. k. Hoforgelbauer Hans Mauracher - zeitgleich mit dem auch von ihm durchgeführten Bau der neuen Orgel in der Innsbrucker Hofkirche - eine neue zweimanualige pneumatische 16-registrige Orgel mit Hängeventilladen. Der Gehäuseentwurf stammt vom Franziskanerpater Johann Maria Reiter.
Bei einer 1969 durchgeführten Reinigung der Orgel wurden die Register Dolce 8‘ und Vox coelestis 8‘ im zweiten Manual durch die Register Oboe 8‘ und ein Nachthorn 8‘ ersetzt. Bereits in der 1980er Jahren jedoch wurden die 1969 eingebauten Register wieder ausgebaut und durch die ursprünglichen Register Dolce 8‘ und Vox coelestis 8‘ ersetzt. 1996 erfolgte am Instrument von Windtner Orgelbau aus Linz in Oberösterreich eine weitere (letzte) Restaurierung, dabei baute Franz Windtner u. a. auch eine neue pneumatische Spieltischeinrichtung in die Orgel ein.
Seit Übernahme der Kirche durch die Serbisch-Orthodoxe Kirche 2019 wird das Instrument nicht mehr gespielt, da die Orgel in der orthodoxen Liturgie nicht verwendet wird.
Neue Universitätskirche - Johanneskirche
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1994 Standort: Nordostempore Instrument: 10-registrige einmanualige mechanische Schleifladen-Orgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
1721 errichtete der Hofbauschreiber Josef Hyacinth Dörflinger an der Stelle der heutigen Kirche eine erste Kapelle. Bereits 1729, im Jahr der Heiligsprechung vom Hl. Johann von Nepomuk, wurde ihm zu Ehren nach Plänen des Hofbaumeisters Georg Anton Gumpp die heutige Barockkirche erbaut. Stand die Kirche ursprünglich noch am Stadtrand, so ist sie heute Mittelpunkt der 1980 gegründeten Universitätspfarre, umgeben u. a. von der Leopold-Franzens-Universität und der Medizinischen Universität Innsbruck.
1993 erhob Bischof Reinhold Stecher die Johanneskirche zur Pfarrkirche der Universitätspfarre und gab ihr den Namen „Neue Universitätskirche St. Johannes am Innrain“.1910 baute die Orgelbaufirma Gebrüder Mayer aus Feldkirch in Vorarlberg eine neue zweimanualige 12-registrige Orgel mit Pedal und freistehendem Spieltisch auf die hochliegende Empore. Die erst nach Fertigstellung der Kirche in der Mitte der Emporenbrüstung errichtete Auskragung lässt vermuten, dass vor der Mayer-Orgel auf der Empore bereits eine frühere Brüstungsorgel oder ein Instrument mit Hauptwerk und Rückpositiv existierte.
Die Mayer-Orgel besaß einen Zink-Prospekt mit drei Pfeifenfeldern in einem klassizistisch nachgebildeten Orgelgehäuse. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde der zentral vor der Orgel freistehende Spieltisch aus Platzgründen auf die Seite versetzt. 1994 baute der Steinacher Orgelbauer Johann Pirchner (Reinisch-Pirchner) eine neue 10-registrige mechanische Schleifladenorgel mit Pedal in einem neuen Gehäuse auf die Empore.
Landschaftliche Pfarrkirche Mariahilf
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1986 Standort: Südempore Instrument: 20-registrige zweimanualige Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Während des Dreißigjährigen Kriegs gelobten die Tiroler Stände in höchster Bedrängnis, bei Abwendung der Kriegsgefahr eine Kirche am Höttinger Bach mit dem Bildnis Mariahilf zu erbauen. Nach Kriegsende errichtete Hofbaumeister Christoph Gumpp von 1648 bis 1660 eine Zentralkuppelkirche im Stil des italienischen Frühbarocks. Der Kirchenbau gehört heute zu den schönsten barocken Sakralbauten Österreichs. 1853 wurde Mariahilf zur Pfarre erhoben.
1834 baute der Innsbrucker Orgel- und Fortepianomacher Johann Georg Gröber eine neue mechanische Schleifladenorgel für die Landschaftliche Pfarrkirche Mariahilf. 1925 errichtete Karl (II) Reinisch aus Steinach am Brenner eine neue zweimanualige pneumatische 20-registrige Orgel mit Pedal, freistehendem frontalen Spieltisch und einer ungefassten neobarocken Weichholzprospektfront mit Zink-Pfeifen.
1949 baute die Steinacher Orgelbaufirma Karl Reinisch‘s Erben die Orgel um, stellte dabei den Spieltisch zwecks Platzgewinnung seitlich auf und fügte zwei Register hinzu.
1986 stellte die Nachfolgefirma Reinisch-Pirchner eine neue mechanische 20-registrige Schleifladenorgel auf: sie versuchte dabei, das Instrument optisch bestmöglich an den Kirchenraum anzupassen und in seinem Aufbau bzw. seiner Disposition den berühmten Orgeln Gottfried Silbermanns (1683-1735) nachzuempfinden.
Wohnung Mariahilf
Erbauer: Friedemann Seitz - Kaufbeuren, Bayern (D) Baujahr: 2024-25 (Fertigstellung April 2025) Standort: Wohnung Mariahilf, Musikzimmer Instrument: 4-registrige mechanische Truhenorgel, transportierbare Tastatur Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch (Registerschieber)
Orgelbauer Friedemann Seitz aus Kaufbeuren in Deutschland baut derzeit eine Truhenorgel für Prof. Mag. Peter Waldner; geplante Fertigstellung ist April 2025. Der Orgelbauer hat dazu folgende Anmerkungen:
„Bei der Verwendung einer Truhe als Continuo-Instrument ist natur-gemäß das Gedackt 8‘ das Hauptregister. Dabei entsteht oft der Wunsch nach einer klanglichen Differenzierung in der 8‘-Lage. Auch ist gerade für die historische Aufführungspraxis eine Truhenorgel mit nur gedeckten Pfeifen oft nicht ausreichend. Diese Möglichkeit wird dadurch realisiert, dass die tiefen Pfeifen der Octave 2‘ für einen Principal 8‘ mit offenen Pfeifen von h0 bis d‘‘ doppelt verwendet werden. Ebenso werden die Pfeifen des Gedackt 4‘ von C bis d‘‘ aus dem Gedackt 8‘ „geborgt“, was ohne klangliche und spieltechnische Einschränkungen für ein rasches Umstimmen, für die Zugänglichkeit und für die Gehäuseabmessungen sowie für das Gewicht von Vorteil ist. Die Schleifen aller Register sind zwischen h und c‘ (bei a‘ 440 Hz) geteilt. Um das Stimmsystem bei unterschiedlichen Stimmtonhöhen (415 / 440 / 465 Hz) frei wählen zu können, sind alle Pfeifen aus Holz. Das Transponieren geschieht durch Umsetzen der Klaviatur. Die Gehäusemaße (Grundfläche) sind 92 x 45 cm, mit Griffen und Profilen 98 x 46.5 cm. Das zum Transport abnehmbare Oberteil ist 72 cm hoch. Im Unterteil (25 cm) sind der Gebläsemotor und Regulierbalg eingebaut. Die Klaviaturhöhe ist bei ca. 104 cm, wenn das Instrument auf einem Rollwagen steht, der mitgeliefert wird.“
Innsbrucker Abendmusik (Verein)
Erbauer: Orgelbau Mebold - Siegen, Nordrhein-Westfalen (D) Baujahr: 2008-09 Standort: Pfarre Mariahilf, Pfarrsaal Instrument: 2-registrige mechanische Truhenorgel, transponierbare Tastatur Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch (ein Registerschieber für Flöte 4‘)
Die zweiregistrige Truhenorgel, 2008-09 von Hans Peter Mebold aus Siegen in Deutschland gebaut, wurde vom Verein „Alte Musik in Innsbruck-Mariahilf“ für die Konzertreihe „Innsbrucker Abendmusik“ angekauft.
Das Orgelgehäuse ist in einer Rahmen-/ Füllungen-Bauweise ausgeführt: Die Rahmen sind aus Kirschholz gefertigt, die Füllungen bestehen aus stabilen Ahorn-Holzgittern. Im Unterbau befinden sich Blasbalg und Elektrogebläse, im oberen Teil sind Windlade, Pfeifenwerk, Mechanik und Klaviatur untergebracht. Die Tasten der Klaviatur sind aus Obstholz gefertigt. Das Instrument besitzt nur Holzpfeifen: Sämtliche Pfeifen sind aus Eichenholz gefertigt. Zum Stimmen und Warten der Orgel kann der Deckel mitsamt der Klaviatur geöffnet und abgenommen werden.
Durch Verschieben der Tastatur ist ein Spiel auf drei verschiedenen Tonhöhen möglich: - Position 1 - Tastatur links, a1 = 415 Hz - Position 2 - Tastatur Mitte, a1 = 440 Hz - Position 3 - Tastatur rechts, a1 = 465 Hz
Das kompakt gebaute Instrument besitzt zum Tragen an beiden Seiten je zwei Haltegriffe. Für den Transport stehen ein Schutzkoffer und ein Rollwagen zur Verfügung. Die Truhenorgel kann von Chorformationen, Gesangs- und Instrumentalensembles oder auch Konzertveranstaltern gegen eine Leihgebühr ausgeliehen werden.
Kontaktinfo: Verein Alte Musik in Innsbruck-Mariahilf (Dr. Wolfgang Unterberger) Dr. Sigismund Epp Weg 1, 6020 Innsbruck E-Mail: wolfgang.unterberger@aon.at
Pfarrkirche St. Nikolaus
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1986 Standort: Ostempore Instrument: 29-registrige zweimanualige Schleifladenorgel mit Hauptwerk, Schwellwerk und Pedal, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Die heutige Pfarrkirche St. Nikolaus wurde von 1881 bis 1886 nach Plänen vom Wiener Dombaumeister Friedrich von Schmidt erbaut und gilt heute als das bedeutendste Denkmal neugotischer Kirchenarchitektur in Tirol. 1845-46 errichtete der Innsbrucker Orgel- und Fortepianobauer Johann Georg Gröber in der Vorgänger-Pfarrkirche eine neue Orgel.
Für die neue Pfarrkirche baute 1885 Franz Weber aus Oberperfuß in Tirol eine neue 23-registrige zweimanualige Orgel und verwendete dabei brauchbare Teile aus der Vorgängerorgel. Der Entwurf des neogotischen Gehäuses stammte vom Kirchenarchitekten.
Die Orgel wurde von Karl Reinisch‘s Erben aus Steinach am Brenner, bedingt durch den II. Weltkrieg in mehreren Etappen, einschneidend umgebaut und vergrößert. 1945-46 konnte das 33-registrige Instrument mit pneumatischen Kegelladen fertiggestellt werden.
1979 wurde der Steinacher Nachfolgefirma Reinisch-Pirchner der Auftrag zum Neubau einer 29-registrigen zweimanualigen mechanischen Schleifladenorgel mit Hauptwerk, Schwellwerk und Pedal ins bestehende neogotische Orgelgehäuse erteilt. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum der Pfarrkirche St. Nikolaus im Jahre 1986 erklang das fertiggestellte Instrument zum ersten Mal. Das Instrument steht auch dem Tiroler Landeskonservatorium als Unterrichts- und Prüfungsinstrument zur Verfügung.
Pfarrkirche Saggen
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1970 Standort: Altarraum seitlich links Instrument: 19-registrige zweimanualige Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Die Stadtpfarre Saggen wurde 1949 gegründet. 1965-1966 erfolgte der Bau der Pfarrkirche nach den Plänen des Innsbrucker Architekten Walter Anton Schwaighofer. Die Kirche besitzt einen sechseckigen Grundriss und ist zweigeschossig: im Untergeschoß befindet sich eine Taufkapelle und ein Pfarrsaal, im Obergeschoß der Kirchenraum - man erreicht ihn über eine langgezogene Rampe; im Norden der Rampe schließt sich der Kirchturm mit den Glocken an.
1970 baute die Orgelbauwerkstatt Reinisch-Pirchner aus Steinach am Brenner eine neue 19-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel mit Hauptwerk, Brustwerk und Pedalwerk. Der Gehäuse- und Prospektentwurf stammt vom Architekten der Kirche, die Disposition erstellte Prof. Karl Benesch. Das Instrument besitzt insgesamt 1358 Pfeifen.
Klosterkirche der Barmherzigen Schwestern
Erbauer: Karl Reinisch‘s Erben - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1960 Standort: Nordwestempore Instrument: 16-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, freistehender Spieltisch Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Nach Gründung des Klosters der Barmherzigen Schwestern des hl. Vinzenz von Paul im Jahre 1836 wurde 1837-38 westlich der Spitalskirche in Innsbruck der erste Klosterbau errichtet.
Bereits 1848 kauften die Barmherzigen Schwestern ein Gebäude im damals noch kaum bebauten Stadtteil Saggen als Versorgungshaus für Schwestern im Ruhestand und errichteten dort 1855 eine Kapelle zur schmerzhaften Muttergottes. 1862 verlegten sie das gesamte Kloster auf das Areal an der Mühlauer Brücke.
Die heutige Klosterkirche zur Unbefleckten Empfängnis Mariä, der Barmherzigen Schwestern des hl. Vinzenz von Paul, entstand von 1881 bis 1883 nach einem Entwurf des Architekten Franz Mayr als Nachbildung der Basilika Santa Maria in Cosmedin in Rom. Die Kirche wurde als dreischiffige Basilika mit einem stark überhöhten Mittelschiff gebaut; sie befindet sich in der Mitte des klösterlichen Gebäudekomplexes. Die reiche Innenausstattung der Klosterkirche stammt vom Bozner Bildhauer Josef Schmid.
1885 bauten die Gebr. Rieger aus Jägerndorf im heutigen Tschechien eine 11-registrige zweimanualige mechanische Kegelladenorgel. 1960 stellte Johann Pirchner aus Steinach am Brenner auf der Empore der Klosterkirche eine neue mechanische 16-registrige zweimanualige Schleifladenorgel mit Pedal und freistehendem Spieltisch auf. Der Gehäuseentwurf stammte vom Innsbrucker Architekten Josef Menardi. Die Orgeldisposition erstellte der an der Innsbrucker Pfarrkirche St. Jakob tätige Chordirektor Karl Koch.
Sanatorium Kettenbrücke - Hauskapelle
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1973 Standort: Empore Instrument: 4-registriges einmanualiges mechanisches Orgelpositiv mit angehängtem Pedal, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Das Sanatorium Kettenbrücke wurde im Jahr 1910 als „Bürgerliches Sanatorium zum heiligsten Herzen Jesu der Barmherzigen Schwestern“ unter tatkräftiger Mithilfe der Barmherzigen Schwestern gegründet. Das heute ca. 150 Betten, verteilt auf sieben Stationen, zählende Haus ist aktuell die größte Privatklinik Österreichs.
1973 baute Johann Pirchner (Reinisch-Pirchner) aus Steinach am Brenner auf der Empore der Hauskapelle des Sanatoriums eine neue einmanualige Orgel mit Flügeltüren und einem Gehäuse aus massivem Eichenholz.
Privatwohnung Saggen - Musikzimmer, Orgel 1
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1977 Standort: Wohnung, Musikzimmer Instrument: 3-registriges einmanualiges mechanisches Orgelpositiv mit angehängtem Pedal, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerhebe
1977 baute Johann Pirchner aus Steinach am Brenner für Christine Neier eine einmanualige mechanische Schleifladenorgel mit kurzer Unteroktav und angehängtem Pedal (C - d 1). Der damalige Axamer Mesner schnitzte die Schleierbretter für den Orgelprospekt. An beiden Seiten des Orgelprospektes befinden sich am Fichtengehäuse Flügeltüren. Nach einem Umbau des angehängten Pedals besitzt das aktuelle Pedal nur mehr 9 Tasten (C - c 0).
Die Orgelweihe fand am 4.4.1979 statt. Das Weihekonzert spielte Prof. Karl Benesch aus Innsbruck. Das Instrument befindet sich im Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden.
Privatwohnung Saggen - Musikzimmer, Orgel 2
Erbauer: Orgelmakerij Reil - Herde, Gelderland (NL) Baujahr: 2000 Standort: Wohnung, Musikzimmer Instrument: 11-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, + 1 Transmission, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
2000 kaufte Christine Neier das Instrument von der Orgelmakerij Reil aus Herde in Niederlande als zweite Haus-/ Übungsorgel für ihre Stadtwohnung.
Die Untertasten der Klaviaturen bestehen aus Bein, die Obertasten aus Ebenholz. Das Eichengehäuse ist mit Firnisöl eingelassen und besitzt an den beiden Seiten des Orgelprospektes Flügeltüren. Die Orgelweihe erfolgte am 3.9.2001. Das Weihekonzert spielte Prof. Rupert Gottfried Frieberger vom Stift Schlägl in Oberösterreich.
Die Orgel ist im Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden.
Evangelische Christuskirche
Erbauer: G. F. Steinmeyer & Co. - Oettingen, Bayern (D) Baujahr: 1905-06 Standort: Westempore Instrument: 13-registrige zweimanualige pneumatische Orgel, freistehender Spieltisch Spieltraktur: pneumatisch Registratur: pneumatisch, Wippschalter
Die Evangelische Christuskirche mit angebautem Pfarrhaus wurde im neuromanischen Stil 1905-06 nach Plänen der Wiener Architekten Klemens Kattner und Gustav Knell erbaut. An der Hinterwand der Westempore wurde zentral ein eigener Platz für die Orgel eingeplant, eine Nische mit halbbogenförmigen Deckenabschluss.
1906, gleich nach Fertigstellung der Kirche, stellte G. F. Steinmeyer aus Oettingen in Bayern dort eine neue 13-registrige zweimanualige pneumatische Orgel mit freistehendem Spieltisch auf.
Das Instrument wurde von Maria von Mangold gestiftet. Es hat eine flache Prospektfront, dessen freistehende Zinkprospektpfeifen nach anglikanischer Art von einem Querbalken gehalten scheinen. Das Instrument ist nahezu unverändert erhalten geblieben und stellt mittlerweile ein wichtiges Klangdenkmal aus der Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts dar. Es ist das einzige Instrument, das die Orgelbaufirma G. F. Steinmeyer & Co. in Tirol gebaut hat.
ORF-Landesstudio Tirol
Erbauer: Orgelbau Metzler AG - Dietikon, Zürich (CH) Baujahr: 1973 Standort: Studio 3 Instrument: 5-registrige einmanualige mechanische Truhenorgel Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Das Gebäude des ORF-Landesstudio Tirol entstand nach Plänen des Wiener Architekten Gustav Peichl (nach einem Grundmuster aller von ihm entworfenen ORF-Landesstudios Österreichs) und wurde am 13.10.1972 eröffnet. 1973 baute Orgelbau Metzler AG aus Dietikon bei Zürich eine 5-registrige einmanualige mechanische Schleifladen-Truhenorgel für das ORF-Landesstudio Tirol.
Die kompakt gebaute Orgel besitzt ein Gehäuse aus massivem Eichenholz; die Untertasten sind aus Ebenholz gefertigt, die Obertasten mit Knochen belegt. Die 11 tiefsten Pfeifen des Gedackt 8‘-Registers sind gedeckte Holzpfeifen; alle restlichen Pfeifen sind aus Orgelmetall (einer Zinn-/Bleilegierung) gefertigt. Die Windversorgung erfolgt mittels eines elektrischen Gebläses, das einen Schwimmer-Magazinbalg mit Orgelwind versorgt.
Canisianum
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br. (A) Baujahr: 1965 Standort: Propter Homines Aula (Mehrzweckraum) Instrument: 15-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Das Canisianum ist einerseits ein neuromanisches Gebäude, das 1910-11 für ein internationales Theologenkonvikt der Jesuiten in der Tschurtschenthalerstraße 7 errichtet wurde. Es ist jedoch auch der Name des Theologenkonvikts „Collegium Canisianum“. Das erste Jesuitenkolleg in Innsbruck, das auch eine Jesuitenschule besaß, wurde von 1562 bis 1573 gebaut. 1587 wurde das Nikolai-Haus als Armenkonvikt errichtet, um mittellosen Schülern den Besuch des Gymnasiums zu ermöglichen. Nach Gründung der Innsbrucker Universität entwickelte sich das Nikolai-Haus zum Studenten- und allmählich zum Theologenkonvikt.
1928 stellten die Gebrüder Mauracher aus Linz in Oberösterreich in der Aula des Canisianums eine neue 16-registrige zweimanualige pneumatische Taschenladenorgel auf. 1938, nach der Schließung des Canisianums durch die Nationalsozialisten, wurde das Instrument in die Theresienkirche auf der Hungerburg übertragen. 1945, gleich nach Kriegsende, erfolgte die Wiedereröffnung des Canisianums.1949 errichtete die Steinacher Orgelbauwerkstätte Karl Reinisch‘s Erben in der Aula des Canisianums eine neue 19-registrige dreimanualige pneumatische Kegelladenorgel.
1964-65 erfolgte eine Neugestaltung der Aula nach Plänen des Innsbrucker Architekten Josef Lackner. Im Zuge der Umgestaltung baute Reinisch-Pirchner aus Steinach am Brenner die dreimanualige Orgel unter Verwendung eines Großteils vom alten Pfeifenmaterial zu einer 15-registrigen zweimanualigen, rein mechanischen Schleifladenorgel um und fügte neu die Register Principal 8‘ (I.), Krummhorn 8‘ (II.) und Fagott 16‘ (Ped.) dazu.
Nach einem weiteren Umbau 1999-2000 wurde die Aula unter der neuen Bezeichnung „Propter Homines Aula“ wiedereröffnet. Die Orgel wurde dabei in die vordere rechte Nische der Aula versetzt und für den neuen Standort noch einmal umgebaut. 2013 übersiedelte das Theologenkonvikt wieder ins Gebäude des Jesuitenkollegs in der Sillgasse; das Canisianum (Gebäude) wurde umgebaut und beherbergt mittlerweile ein Studentenheim der Akademikerhilfe.
Kloster zur Ewigen Anbetung
Erbauer: Franz (II) Reinisch - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1905 Standort: Kloster der Ewigen Anbetung, oberer Betchor Instrument: 15-registrige zweimanualige pneumatischeTaschenladenorgel, freistehender Spieltisch Spieltraktur: pneumatisch Registratur: pneumatisch, Registerwippen
Der Orden der Ewigen Anbetung wurde 1807 in Rom gegründet. Von 1868 bis 1870 wurde in der Anlage des ehemaligen HofHirschangers in Saggen das heutige Kloster als einziges Ordenskloster im deutschsprachigen Raum erbaut; 1872 erfolgte die Klosterweihe.
1940 wurde das Kloster von den Nationalsozialisten aufgehoben; 1945 - nach Kriegsende - erfolgte die Übernahme des Klosters durch die überlebenden Schwestern des Ordens. 1905 errichtete Franz (II) Reinisch aus Steinach am Brenner eine neue 15-registrige zweimanualige pneumatische Orgel im oberen Betchor hinter dem Chorraum der Kirche; durch eine Fensteröffnung konnte man die Orgel in der Kirche wie ein leises Fernwerk hören. Nach dem Ende des 1. Weltkriegs wurden die im Krieg eingezogenen Prospektpfeifen durch neue Zinkprospektpfeifen ersetzt.
Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurde am Instrument gearbeitet und dabei die Disposition wie folgt einschneidend verändert: - I. Manual: Bourdon 8‘ (statt Bourdon 16‘), Dolce 8‘ (vom II. Man., statt Salicional 8‘), Quint 22/3‘ (dafür Traversflöte 4‘ ins II. Man.), Mixtur 2‘ (aus Mixtur 22/3‘) - II. Manual: Traversflöte 4‘ (vom II. Man., statt dem ins I. Man. versetzten Dolce 8‘), Flöte 2‘ (statt Fugara 4‘); - Pedal: Bourdon-Bass 8‘ (statt Bourdon-Bass 16‘).
In den 1990er Jahren wurde bei Mauerarbeiten an der Wand hinter der Orgel der Windkanal vom Blasbalg zur Orgel zugemauert. Seither kann die ansonsten intakte Orgel nicht mehr gespielt werden.
Pfarrkirche Dreiheiligen
Erbauer: Orgelbau Metzler AG - Dietikon, Zürich (CH) Baujahr: 1969 Standort: Nordempore Instrument: 10-registrige (+ 1 Transmission) zweimanualige Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Die Dreiheiligenkirche wurde 1612-13 als Gelöbnis-Erfüllung angesichts der damaligen Pest erbaut. Dreiheiligen war ursprünglich ein Benefizium, wurde 1786 zur Expositur und 1926 schließlich zur eigenständigen Pfarre erhoben.1680 erhielt die Kirche eine erste Orgel, erbaut vom Wiltener Orgelmacher Johannes Hackhofer, einem Schüler von Daniel Herz.
Von 1745 bis 1750 wurde die Kirche im Rokoko-Stil umgebaut. 1845-46 erneuerte der aus Umhausen im Ötztal in Tirol stammende, seit 1834 in Innsbruck tätige Orgelbauer Josef Mohrherr unter Verwendung des Altbestandes die Orgel. Im Zuge eines Vergrößerungsumbaus der Pfarrkirche Dreiheiligen baute man 1863 auch eine neue Musikempore; 1883 wurde dort auch eine neue Orgel von der k.u.k. Hoforgelfabrik Gebrüder Rieger aus Schwarzach in Vorarlberg errichtet.
1932 folgte ein 23-registriger elektropneumatischer Orgelneubau von Karl (II) Reinisch aus Steinach am Brenner, unter Verwendung des Mittelteils der Gehäusefront der Vorgängerorgel. In den 60er-Jahren häuften sich die Gebrechen der Reinisch-Orgel, sodass man sich schließlich für einen Orgelneubau entschloss.
1969 baute die Schweizer Orgelbaufirma Metzler AG eine neue mechanische 11-registrige zweimanualige Schleifladenorgel mit Pedal auf die Musikempore; das zweite Manual besitzt nur ein Regal 8‘-Register, welches der Bauweise einer Vox humana entspricht. Allerdings verfügt dessen Windlade noch über Leerschleifen für drei weitere Register. Die gehämmerten Metallpfeifen im Inneren des Gehäuses weisen eine hohe bleihaltige Legierung auf. Die Fertigstellung der Orgel erfolgte kurz vor Weihnachten 1969.
Stiftskirche Wilten - 2. Westempore
Erbauer: Verschueren - Heythysen, Limburg (NL) Baujahr: 2008 Standort: 2. Westempore Instrument: 53-registrige dreimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielnische (Festorgel) Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Im Stift Wilten sind bereits aus dem 16. Jahrhundert Tätigkeiten von Orgelbauern dokumentiert. Ca. 1670 stellte Daniel Herz eine neue einmanualige Chororgel mit Pedal, wahrscheinlich im Altarraum der Stiftskirche, auf. Vermutlich etwa zur gleichen Zeit begann Daniel Herz auch mit dem Bau einer Hauptorgel mit Hauptwerk, Rückpositiv und Pedal auf der Westempore; er starb allerdings vor Fertigstellung des Orgelwerks. Sein Mitarbeiter Johann Hackhofer vollendete das Werk. Das Instrument hielt sich über 150 Jahre.
1839 musste es einem Neubau weichen: Der Innsbrucker Klavier- und Orgelbauer Johann Georg Gröber errichtete auf der zweiten Westempore eine neue 29-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel mit freistehendem Spieltisch. Johann Bodmer fertigte das Orgelgehäuse, welches optisch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem der Humpelorgel (erbaut 1725) in der Pfarrkirche St. Jakob in Innsbruck hatte. 1944 wurde die Orgel durch einem Bombenvolltreffer zerstört. In den Jahren des Wiederaufbaus des Stiftes und der Stiftskirche fehlten die finanziellen Mittel für den Bau einer neuen Hauptorgel auf der Westempore: Bis 1964 musste stattdessen die Herz-Chororgel als Hauptorgel fungieren.
Erst 1964, im Jahr der Olympischen Winterspiele in Innsbruck, konnte der Kremser Orgelbauer Gregor Hradetzky in der Stiftskirche eine neue 40-registrige viermanualige mechanische Schleifladenorgel auf der 2. Westempore errichten. Die Orgel wurde bald ein beliebtes Konzertinstrument und fixer Bestandteil des 1969 in der Stiftskirche Wilten gegründeten Paul-Hofhaimer-Wettbewerbs. In den darauffolgenden Jahrzehnten häuften sich allerdings zunehmend Mängel und Gebrechen an der Orgel. 1989 beschloss der damalige Abt Alois Stöger OPraem nach langem Abwägen, kein Geld mehr für eine anstehende Restaurierung zu investieren.
Das letzte Orgelkonzert an der Hradetzky-Orgel (im Rahmen der Pfingstorgelwoche) fand am 8.6.1990 statt. Im Zuge der Restaurierung der Stiftskirche Wilten von 2005 bis 2008 wurde die Orgel 2005 abgebaut, nach Niederösterreich verkauft und auf der Empore der Pfarrkirche Stephanshart in der Marktgemeinde Ardagger, Amstetten, aufgestellt. 2008 baute die niederländische Orgelbaufirma Verschueren die vierte Orgel (Festorgel) auf die 2. Westempore der Stiftskirche: mit drei Manualwerken, Pedalwerk und insgesamt 53 Registern. Für die Windversorgung der Manualwerke und das Kleinpedal stehen vier Keilbälge (90 mmWS) sowie ein Magazinbalg für das Großpedal (99 mmWS) zur Verfügung.
Die Formensprache des Gehäuses bezieht sich auf die Elemente des barocken Kirchenraums, angestrebt wird dabei eine optische Korrespondenz zum 19 Meter hohen Hauptaltar. Das Instrument ist klanglich und stilistisch an die klassisch niederländische Orgel um 1750 orientiert. Die Grundlage dafür bilden die Verwendung traditioneller Materialien, kunsthandwerkliche Verarbeitung und der Verzicht auf moderne Spielhilfen.
Stiftskirche Wilten - Altarraum
Erbauer: Orgelmakerij Reil - Heerde, Gelderland (NL) Baujahr: 2008 Standort: Altarraum Instrument: 14-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, + 1 Transmission, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Im Zuge der Stiftskirchenrestaurierung von 2005 bis 2008 beschloss der Konvent, das noch vollständig vorhandene klassizistische Chorgestühl von 1791 wiederherzustellen. Allerdings verstellte durch dessen Wiederherstellung die sich zuvor neben dem Chorgestühl befindende und erst 1996 angeschaffte 15-registrige zweimanualige Pirchner-Chororgel genau den neuen Zugang zum Chorgestühl. Schweren Herzens wurde nach längeren Überlegungen 2005 die Pirchner-Chororgel nach Schönegg in Hall verkauft und dort in der Pfarrkirche St. Franziskus-Schönegg aufgestellt.
Im gleichen Jahr beauftragte Abt Raimund Schreier OPraem die Orgelmakerij Gebrüder Reil aus Heerde (Niederlande) mit dem Bau einer neuen Chororgel für die neue Presbyteriums-Situation. Reil stellte gegenüber vom Abtstuhl, mittig vor dem südlichen Wandpfeiler, eine neue 14-regristrige zweimanualige Chororgel mit Hauptwerk, Rückpositiv und Pedal auf. Die Trakturen zum Rückpositiv versenkte er im Boden.
Den goldenen Zierrat mitsamt Schleierbrettern schnitzte Marius van Wijk, die Vergoldungen führte Mario Wehinger durch. Die Windversorgung erfolgt über zwei einfältige Keilbälge, welche übereinander in einem Gang hinter dem Chorgestühl untergebracht sind. Der Winddruck der Orgel beträgt 62,5 mmWS. Das Orgelgehäuse ist aus massivem Nussholz gefertigt.
Stiftskirche Wilten - Nördliche Seitenempore
Erbauer: Daniel Herz - Brixen/Innsbruck, Tirol (A) Baujahr: ca. 1670 Restauriert: 2003, Jürgen und Hendrik Ahrend - Leer, Friesland (D) Standort: Langhaus, nördliche Seitenempore Instrument: 10-registrige einmanualige, mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Ca. 1670 errichtete der seit 1656 in Innsbruck ansässige Orgelmacher Daniel Herz für die Stiftskirche Wilten eine 10-registrige einmanualige Chororgel, möglicherweise für den Altarraum der Stiftskirche. Herz, ein qualitativ herausragender Orgelbauer, baute das Instrument streng nach dem Extensionssystem: Aus drei principalischen Pfeifenreihen konnte er so durch mehrfache Ausnutzung von Pfeifen insgesamt 9 Manualregister gewinnen. Der Tonumfang vom Manual und Pedal sowie die mitteltönige Stimmung entsprachen den damaligen Gepflogenheiten.
Die fast original erhaltene Herz-Chororgel gehört zu den ältesten erhaltenen Orgeln Tirols und ist ein seltenes Beispiel einer nach italienischem Klangaufbau orientierten Ripieno-Orgel nördlich der Alpen: ein herausragender Orgelschatz! Im Laufe der Jahrhunderte erfolgten diverse Arbeiten an der Orgel: Instandsetzungen, Säuberungen und Balgreparaturen.
Im 1. Weltkrieg mussten glücklicherweise die Prospektpfeifen der Herz-Orgel nicht für Munitionszwecke abgegeben werden. In der Zwischenkriegszeit stand das Instrument in der Prälatur (im Gartensaal oder Norbertisaal) und verblieb dort bis 1944. Aufgrund zunehmender Bombengefahr bauten Wilhelm Zika aus Ottenheim und Franz (VI) Reinisch aus Steinach am Brenner am 7./8.2.1944 die Pfeifen der Herz-Orgel aus, verpackten sie in Kisten und lagerten sie im Sommer 1944 im Stift Stams ein. Nach Ende des 2. Weltkriegs wurden die Kisten mit den Orgelpfeifen im Gang hinter dem Chor der Stiftskirche gelagert.
1952, nach Wiederherstellung der im Krieg zerbombten Westempore, beschloss der Konvent, das Instrument wieder spielbar zu machen und bis zur möglichen Anschaffung einer neuen Hauptorgel auf der 2. Westempore aufzustellen. Die Arbeiten führte Wilhelm Zika aus St. Florian bei Linz noch vor Weihnachten 1952 durch, dabei erhielt die Orgel einen Elektromotor und das Orgelgehäuse einen schwarzen Anstrich.
1963, kurz vor Errichtung der neuen 40-registrigen Hradezky-Orgel auf der 2. Westempore, versetzte der Kremser Orgelbauer Gregor Hradetzky die Herz-Chororgel auf den heutigen Standort: das zweite nördliche Chorjoch über dem Chorgestühl. Dabei wurden leider die alten Faltenbälge der Orgel entfernt und durch einen neuen kleinen Balg ersetzt.
Bereits 1968 baute der Steinacher Orgelbauer Johann Pirchner einen neuen Schwimmerbalg ins Instrument ein und fertigte zudem eine neue Pedalanhängung sowie eine Abstellvorrichtung für den Subbass 16‘. 2003 führten Jürgen und Hendrik Ahrend aus Leer-Loga (Deutschland) eine gründliche Restaurierung bzw. Generalsanierung an der Herz-Orgel durch. Abgesehen von den notwendigen Reparaturen bereinigten sie dabei auch die Veränderungen der Orgel nach dem 2. Weltkrieg und rekonstruierten die ursprüngliche Keilbalganlage, welche bei Bedarf mittels zweier Seilzüge (statt mit Elektromotor) befüllbar ist.
Stiftskirche Wilten - Südliche Seitenempore
Erbauer: unbekannt Baujahr: ca. 1650 Restauriert: 1961, Instandsetzung; 2024, Hendrik Ahrend - Leer, Friesland (D) Standort: ca. 1650-1957 Pfarrkirche Hall in Tirol, Waldaufkapelle; 1961-69 Kirche St. Korbinian, Assling in Osttirol; 1969-2022 Pfarrkirche Lans in Tirol; seit 2024 Stiftskirche Wilten, seitliche Südempore Instrument: 7-registrige einmanualige, mechanische Schleifladenorgel, Spielnische (Salve-Orgel) Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Der Erbauer des um ca. 1650 entstandenen 6-registrigen einmanualigen Orgelpositivs ist nach derzeitigem Quellenstand nicht bekannt. Die Orgel wurde in der Waldaufkapelle in der Pfarrkirche Hall in Tirol aufgestellt und stand dort bis 1957.In der Literatur wird das Instrument öfters auch als „Salve-Örgele“ bezeichnet: Der Name ist ein Hinweis auf die von Kaiser Maximilian I. geförderte Waldaufstiftung, welche seit dem Jahr 1497 die tägliche Abhaltung des gesungenen Salve Regina festlegte.
1957 wurde das Instrument mit Landesmitteln von der Pfarre Assling in Osttirol erworben, 1961 instandgesetzt und in der Filialkirche St. Korbinian in Assling aufgestellt. Aufgrund von Spielproblemen mit der bei der Orgel vorhandenen kurzen Bassoktav wurde das Orgelpositiv allerdings bereits 1969 in die Pfarrkirche Lans in Tirol transferiert und auf der dortigen Empore aufgestellt, wo es bis 2022 gespielt wurde. Im Zuge eines 14-registrigen zweimanualigen Orgelneubaus in der Pfarrkirche Lans wurde das Instrument durch Orgelbau Linder aus Nußdorf am Inn in Bayern ins Stift Wilten transferiert.
2024 erfolgte eine umfassende Restaurierung durch Hendrik Ahrend aus Leer aus Ostfriesland, der die Orgel auf der südlichen Seitenempore gegenüber der Herzorgel aufstellte, um ein Pedal mit einem Subbass 16‘-Register erweiterte, die Metallpfeifen im Gehäuse rekonstruierte und einen Kanaltremulant einbaute.
Das Instrument besitzt die gleiche mitteltönige Stimmung und Tonhöhe, wie die sich auf der gegenüber liegenden nördlichen Seitenempore befindende Herz-Orgel und eignet sich so sehr gut zum doppelchörigen Zusammenspiel.Mit den beiden 8‘- und 4‘-Registern kann sowohl kammermusikalisch musiziert als auch - wie ursprünglich in der Stadtpfarrkirche Hall vorgesehen - beim gesungenen Chorgebet begleitet werden.
Stiftskirche Wilten - mobile Orgel
Erbauer: Henk Klop - Garderen, Gelderland (NL) Baujahr: 2006 Standort: mobil, je nach Bedarf Instrument: 2-registrige einmanualige, mechanische Truhenorgel, mit ins Gehäuse versenkbarer Tastatur Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, geteilte Registerzüge
Die zweiregistrige Truhenorgel mit geteilten Registern wurde 2006 von Henk Klop aus Garderen in den Niederlanden gebaut. Das Instrument hat ein massives Eichengehäuse, Schleierbretter mit barocken Blumenmotiven und besitzt nur Holzpfeifen. Die Untertasten der Klaviatur sind mit Ebenholz belegt, die Obertasten mit Ahorn. Die Windanlage der Orgel befindet sich im Gehäuse, der Winddruck beträgt 50 mmWS.
Die Truhenorgel kann durch Verschieben der Tastatur auf vier verschiedenen Tonhöhen gespielt werden: - Position 1 - Tastatur links, a1 = 392 Hz (Bass-/Diskantteilung: cis1/d1) - Position 2 - Tastatur links, a1 = 415 Hz (Bass-/Diskantteilung: c1/cis1) - Position 3 - Tastatur Mitte, a1 = 440 Hz (Bass-/Diskantteilung: h0/c1) - Position 4 - Tastatur rechts, a1 = 465 Hz (Bass-/Diskantteilung: b0/h1)
Das Instrument ist leicht und kompakt gebaut (113 x 84 x 44 cm), hat zum Tragen an den beiden Seiten je zwei versenkbare Haltegriffe eingebaut und ein Gesamtgewicht von 73 kg.
Stiftskirche Wilten - Erste Westempore
Erbauer: Henk Klop - Garderen, Gelderland (NL) Baujahr: 2015 Standort: 1. Westempore Instrument: 2-registrige einmanualige mechanische Truhenorgel, mit ins Gehäuse versenkbarer Tastatur Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, geteilte Registerzüge
Die zweiregistrige Truhenorgel wurde im Jahr 2015 bei Henk Klop aus Garderen in den Niederlanden angekauft. Das Instrument besitzt ein Gehäuse aus massivem Kirschholz und Schleierbretter mit barocken Blumenmotiven, ist kompakt und leicht gebaut (113 x 84 x 44 cm), hat nur Holzpfeifen sowie geteilte Register (c1/cis1, h0/c1 oder b0/h0). Durch Tastaturverschiebung ist das Instrument auf drei verschiedenen Tonhöhen spielbar. Die Untertasten der Klaviatur sind mit Ebenholz belegt, die Obertasten mit Pflaumenholz. Die Windanlage der Orgel befindet sich im Gehäuse, der Winddruck beträgt 50 mmWS.
Wiltener Sängerknaben
Erbauer: Henk Klop - Garderen, Gelderland (NL) Baujahr: 2001 Standort: Probenraum der Wiltener Sängerknaben Instrument: 4-registrige einmanualige mechanische Truhenorgel, mit ins Gehäuse versenkbarer Tastatur Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, geteilte Registerzüge
Die Wiltener Sängerknaben gelten als einer der traditionsreichsten und renommiertesten Knabenchöre Europas. Ihre Geschichte reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück: Bereits 1235 bestand in Wilten eine Stiftsschule für Knaben. Die Wiltener Sängerknaben bestehen derzeit aus ca. 190 Sängern, welche in Kooperation mit dem Tiroler Landeskonservatorium in fünf verschiedenen Formationen ausgebildet werden. 2001 kaufte der Verein der Freunde der Wiltener Sängerknaben eine 4-registrige Truhenorgel von Henk Klop aus Garderen in den Niederlanden.
Das Instrument besitzt ein massives Eichengehäuse, Schleierbretter mit barocken Blumenmotiven, geteilte Register, hat nur Holzpfeifen und an beiden Seiten je zwei versenkbare Haltegriffe. Die Untertasten der Klaviatur sind mit Ebenholz belegt, die Obertasten mit Ahorn. Die Windanlage der Orgel befindet sich im Gehäuse, der Winddruck beträgt 50 mmWS. Die Truhenorgel, von den Wiltener Sängerknaben liebevoll auch „chouchou“ genannt, kann man durch Tastenverschiebung auf drei verschiedenen Tonhöhen spielen: a1 = 415 Hz / 440 Hz / 465 Hz.
Nach Auflösung des Vereins der Freunde der Wiltener Sängerknaben gelangte die Klop-Truhenorgel in den Besitz des Tiroler Landeskonservatoriums, welches das Instrument seither den Wiltener Sängerknaben und dem Mädchenchor Wilten zur Nutzung für den Proben- und Konzertbetrieb zur Verfügung stellt.
Basilika Wilten
Erbauer: Franz (II) Reinisch - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1894 (Orgelgehäuse von 1758) Restauriert: 2003, Orgelbau Pirchner- Steinach a. Br., Tirol (A) Standort: Westempore Instrument: 24-registrige zweimanualige mechanische Kegelladenorgel, freistehender Spieltisch Spieltraktur: mechanisch, Barkermaschine fürs I. Manual Registratur: mechanisch, Registerzüge, Kombinationstritte
Die Basilika Wilten, genannt auch „Basilika Unsere Liebe Frau von der unbefleckten Empfängnis“ oder „Unserer Lieben Frau unter den vier Säulen“, dient als Pfarrkirche der Pfarre Wilten und ist überdies eine vielbesuchte Wallfahrtskirche.
Als älteste katholische Pfarre der Region gilt sie als Mutterpfarre der Stadt Innsbruck; bereits seit 1140 wird sie von den Prämonstratensern vom gegenüberliegenden Stift Wilten betreut. Die heutige Kirche gilt als wohl schönste Rokokokirche Tirols. Sie wurde von 1751 bis 1755 nach Plänen des Tiroler Priesters und Architekten Franz de Paula Penz als Wandpfeilerkirche mit dreigeschossiger Doppelturmfassade und als Ersatz für die baufällig gewordene Vorgängerkirche errichtet. Im Zentrum des Hochaltars befindet sich eine ca. 90 cm große gotische Muttergottesstatue mit Kind aus Sandstein, geschaffen zwischen 1300 und 1350.
Unter dem Kirchenbau sind noch Reste einer bereits im 5. Jahrhundert errichteten Kirche vorhanden. Aufgrund ihrer historischen Bedeutung erhob Papst Pius XII im Jahr 1957 die Wiltener Pfarrkirche zur päpstlichen „Basilica minor“. 1758 errichtete Anton Fuchs aus Gries am Brenner ein Orgelwerk auf der Westempore der Kirche. Das Orgelgehäuse stammte vom Tischler Franz Zängl.
1894 baute Orgelbauer Franz (II) Reinisch aus Steinach am Brenner ins bestehende Rokoko-Gehäuse (von 1758) eine neue 24-registrige mechanische Kegelladenorgel mit Pedal, freistehendem Spieltisch und Barkermaschine fürs I. Manual. Das Instrument ist - entsprechend der damaligen Zeit - romantisch konzipiert, mit insgesamt zehn 8‘-Registern für die beiden Manualwerke!
Im 20. Jahrhundert erfolgte im Zuge von Restaurierungsarbeiten durch Orgelbau Reinisch-Pirchner aus Steinach am Brenner auch eine kleine Dispositionänderung: Im II. Manual wurden die Register Flauto 8‘ und Fugara 4‘ durch Oktav 2‘ und Mixtur 3fach, im Pedal das Register Cello 8‘ durch Oktav 4‘ ersetzt.
2003 führte Orgelbau Pirchner aus Steinach am Brenner eine umfassende Restaurierung am Instrument durch. Pirchner stellte dabei die ursprüngliche Disposition wieder her und versetzte die Orgel so wieder in ihren klanglichen, romantischen Zustand von 1894 zurück. Das Instrument, das sich bis in die Gegenwart nahezu unverändert erhalten hat, gilt mittlerweile als einzigartiges Klangdenkmal.
Pädagogische Hochschule Tirol
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1979 Standort: Musikzimmer Instrument: 3-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Die Pädagogische Hochschule Tirol (PHT) entstand 2007 als Zentrum für Aus-, Fort- und Weiterbildung für Lehrer in Tirol durch die Zusammenlegung der Pädagogischen Akademie mit den zuvor für die Fort- und Weiterbildung zuständigen Pädagogischen Instituten und der Berufspädagogischen Akademie. Angeboten werden die Studien für die Lehrämter in den Schulen der Primarstufe (Volksschule / Sonderschule), der Sekundarstufe (Neue Mittelschule, Sonderschule, Polytechnische und Allgemeinbildende Höhere Schule) sowie der Sekundarstufe Berufsbildung (Berufsschule).
1979 baute die Steinacher Orgelbauwerkstatt Reinisch-Pirchner für die damals Pädagogische Akademie Innsbruck eine dreiregistrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel mit angehängtem Pedal.
Das Orgelgehäuse mit den verschließbaren Flügeltüren sowie die Pedalklaviatur besteht aus massivem Eichenholz; die Untertasten sind aus Buchsbaum, die Obertasten aus Ebenholz gefertigt.
Pfarrkirche Wilten-West
Erbauer: Walcker-Mayer - Guntramsdorf, Niederösterreich (A) Baujahr: 1964 Standort: Südempore Instrument: 16-registrige zweimanualige, mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Gegen Ende des 19. Jahrhundert wuchs die Bevölkerung, nach Eröffnung der Arlbergbahn und der Haltestelle Wilten, dem heutigen Westbahnhof, stark an. Bereits 1888 wurde ein erster Kirchenbauverein gegründet; ein Kirchenneubau konnte jedoch erst von 1955 bis 1957 nach Plänen von Baurat Hermann Jung und Architekt Flür und Überarbeitung von Martin Eichberger erfolgen.
1964 errichtete die Orgelbaufirma Walcker-Mayer aus Guntramsdorf in Niederösterreich eine 16-registrige, zweimanualige Schleifladenorgel mit Pedal auf der Südempore der Kirche. 2014 erfolgte eine Generalüberholung des Instrumentes durch die Orgelbaufirma Erler aus Schlitters im Zillertal.
Pfarrkirche Pradl
Erbauer: Alois Fuetsch - Lienz, Osttirol (A) Baujahr: 1914 Umbauten: 1957, Michael Weise - Plattling, Bayern (D) & Gebrüder Mayer - Feldkirch, Vorarlberg (A); 1990, Erler Orgelbau - Schlitters im Zillertal (A); 2010-12, Rösel & Hercher- Saalfeld, Thüringen (D); 2015, Rösel - Saalfeld, Thüringen (D) Standort: Ostempore Instrument: 47-registrige dreimanualige pneumatische Taschen-/ Kegelladenorgel, mit 12 Transmissionen, 3 Extensionen, freistehender Spieltisch mit Setzeranlage Spieltraktur: elektropneumatisch Registratur: elektrisch, Registerzüge / Pistons
Pradl bestand ursprünglich als Weiler aus einigen Bauernhöfen und gehörte zur Mutterkirche Ampass.1674 wurde eine kleine hölzerne Kapelle gebaut und in ihr eine Kopie des Gnadenbildes Mariahilf von Lukas Cranach (in der heutigen Innsbrucker Dompfarrkirche) aufgestellt. Die Kapelle wurde bald zum Ziel von Pilgern.
1677-78 erfolgte ein Kirchenneubau, nach Fertigstellung wurde das Gnadenbild auf dem dortigen Hochaltar aufgestellt. 1891 wurde Pradl zur selbstständigen Pfarre erhoben.Nach Errichtung des Bahnhofs 1858 wuchs Pradl rasch, die Pfarrkirche wurde bald zu klein. 1905-08 erfolgte ein Kirchenneubau im neuromanischen Stil nach Plänen des Architekten Josef Schamitz aus Nürnberg.
Die heutige Orgel baute Orgelbauer Alois Fuetsch aus Lienz, Osttirol, 1914 als 31-registriges zweimanualiges Instrument mit pneumatischen Trakturen und Taschenladen. Da die meisten Metallpfeifen aus Zink gefertigt wurden, konnten die Pfeifen bei beiden Weltkriegen in der Orgel verbleiben, wodurch auch der bemalte Orgelprospekt erhalten blieb. Im Dezember 1944 wurde infolge einer Bombardierung das Kirchendach und die Orgel stark beschädigt; vermutlich war die beschädigte Orgel in den folgenden Jahren nur sehr eingeschränkt spielbar.
1957 erfolgte eine Restaurierung bzw. ein Umbau des Instrumentes durch die Orgelbauer Michael Weise aus Plattling in Bayern und Gebrüder Mayer aus Feldkirch in Vorarlberg. Zu Beginn der 2000er Jahre wurden die Gebrechen an der Orgel häufiger. Es folgten Diskussionen über eine mögliche Zukunft des Instrumentes. Man entschied sich für eine Generalsanierung der Orgel und beauftragte 2010 die Orgelbaufirma Rösel & Hercher Orgelbau aus Saalfeld in Thüringen mit den diesbezüglichen Arbeiten. Dabei wurde das Instrument unter Beibehaltung des Gehäuses, der Pfeifen und Windladen technisch fast komplett erneuert, ein neuer Spieltisch gebaut und die Disposition der Orgel erweitert.
Als die große Fuetsch-Orgel in der Stiftsbasilika Stams in Tirol 2015 einem Orgelneubau weichen musste, wurden von Orgelbauer Andreas Rösel folgende besonders gut klingende Register in der Orgel eingebaut: Gemshorn 8‘ (I), Prinzipal 8‘ (II, große Oktav), Krummhorn 8‘ (II), Viola d‘amour 8‘ (III), Fugara 4‘ (III) und Trompette harmonique 8‘ (III).
Schutzengelkirche Neu-Pradl
Erbauer: Karl Reinisch‘s Erben - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1959 Standort: Südempore Instrument: 17-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, freistehender Spieltisch Spieltraktur: mechanisch Registratur: pneumatische Registratur, Wipptasten
Der Stadtteil Pradl wuchs im 20. Jahrhundert, vor allem auch durch den Bau der Südtiroler Siedlung von 1939 bis 1942 rasch: 1946 lebten dort bereits über 17.000 Einwohner, weshalb im Osten von Pradl die Errichtung einer neuen Pfarre (Pradl Ost bzw. Neu-Pradl) geplant wurde.1949-50 fungierte eine Baracke als Notkirche.
Von 1950 bis 1953 wurde die neue Kirche nach Plänen des damals sehr jungen Architekten Karl Friedrich Albert gebaut und den Heiligen Schutzengeln geweiht. 1959 baute Orgelbauer Johann Pirchner (Reinisch-Pirchner) aus Steinach am Brenner eine neue 17-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel mit pneumatischer Registratur auf die Empore.
Der Gehäuseentwurf stammt vom Kirchenarchitekten: Johann Pirchner musste nach dessen Entwurf ein Instrument - verteilt auf zwei Gehäuseteile - bauen, um das zentrale Rosettenfenster an der Rückwand der Empore frei zu lassen. Die 110 größten Pfeifen baute er damals noch in Elektrolyt-Zink, das restliche Pfeifenwerk aus Zinn-Blei-Legierung und Holz. Die Disposition erstellte Chorleiter J. Sigmund.
Pfarrkirche St. Norbert, Pradl-Süd
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1987 Standort: Altarraum, links Instrument: 11-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wuchs die Pfarrgemeinde Pradl stetig an und wurde so mehrmals geteilt. Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtete Konradkapelle wurde allmählich zu klein. Man schrieb einen Architekturwettbewerb für den Bau einer größeren Kirche aus, den der bekannte Innsbrucker Architekt Josef Lackner gewann.
1970-71 erfolgte der Neubau: ein niedriger zweigeschossiger quadratischer Mehrzweckbau mit Kirchenraum und Sakristei im Obergeschoß und Pfarrwohnung sowie Gemeinderäumlichkeiten im Untergeschoß. Das an den Seiten steile Dach erstreckt sich an den Ecken bis zum Boden und gibt dem turmlosen Bau einen zeltartigen Charakter.
Zu Beginn der 2000er Jahre wurde das gesamte Gebäude zunehmend sanierungsbedürftig und es zeigten sich größere Bauschäden. Wie aus einem Zeitungsbericht der Tiroler Tageszeitung vom 16.3.2012 hervorgeht, wurde damals sogar ein Abbruch der Kirche diskutiert. Mittlerweile steht die Kirche unter Denkmalschutz.
1987 baute Orgelbauer Johann Pirchner (Reinisch-Pirchner) aus Steinach am Brenner eine einmanualige mechanische Schleifladenorgel mit teils geteilten Registern, die er links neben dem zentralen Altarbereich aufstellte. Das Gehäuse ist aus Fichte gefertigt; die Untertasten sind mit Ebenholz belegt, die Obertasten mit Rindsknochen.
Auferstehungskirche
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1996 Standort: Westempore Instrument: 20-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Nach dem 2. Weltkrieg wuchs die Evangelische Kirchengemeinde in Innsbruck stark an.1959, nach Vergabe der Olympischen Winterspiele 1964 an Innsbruck, beschloss der damalige evangelische Pfarrer Wolfgang Liebenwein den Bau einer zweiten evangelischen Kirche, neben der bereits seit 1906 bestehenden Christuskirche.
1962 konnte der Kirchenbau in der Reichenau nach Plänen des Innsbrucker Architekten-Ehepaars Charlotte und Karl Pfeilerunter dem Projektnamen „Olympiakirche“ begonnen werden: Es entstand ein zeltförmiges Kirchengebäude mit einem steilen Rhombendach über einem annähernd quadratischen Grundriss. An drei Seiten wurden die Giebelwände fast zur Gänze mitfarbigen Glasfenstern ausgestattet. Der schlichte Innenraum ist geprägt von schlanken fächerartigen Stahlbetonrippen. Der schlanke Glockenturm wurde freistehend errichtet und an auf die Spitze ein Kreuz mit Weltkugel platziert. Die Einweihung erfolgte am 19.1.1964, 10 Tage vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele. Die Kirche diente während der Olympischen Spiele als Gottesdienstzentrum für die evangelischen Teilnehmer und Besucher. Sie steht mittlerweile unter Denkmalschutz.
1968 erfolgte der Bau des Pfarr- und Gemeindehauses. Noch im gleichen Jahr wurde die Gemeinde aus der Muttergemeindeausgegliedert und zur Tochtergemeinde; 1970 erfolgte die Umwandlung in eine selbstständige Pfarrgemeinde. 1996 errichtete die Steinacher Orgelbaufirma Reinisch-Pirchner auf die bestehende Westempore der Kirche eine neue 20-registrige zweimanualige mechanische Scheifladenorgel mit Hauptwerk, Oberwerk und Pedal. Das Orgelgehäuse ist ausmassivem Fichtenholz gefertigt; die Untertasten sind aus Ebenholz gefertigt, die Obertasten mit einer Beinauflage versehen.
Die Orgel eignet sich aufgrund ihrer Disposition und klanglichen Konzeption besonders gut zur Interpretation von Kompositionen aus dem Barock, unter anderem von Johann Sebastian Bach. Aufgrund einer Vereinbarung des Tiroler Landeskonservatoriums mit der Evangelischen Pfarrgemeinde der Auferstehungskirche kann das Instrument von den Orgelstudenten zum Üben sowie für Unterricht, Konzerte und Prüfungen verwendet werden.
2023-24 wurde an der Auferstehungskirche eine Generalsanierung bzw. Restaurierung durchgeführt; die Wiedereröffnung im Rahmen eines Festgottesdienstes erfolgte am 23.6.2024.
Pfarrkirche St. Paulus
Erbauer: Walcker-Mayer - Guntramsdorf, Niederösterreich (A) Baujahr: 1970 Standort: Westempore Instrument: 25-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
In der Reichenau in Innsbruck entstand ab 1952 ein neuer Stadtteil mit über 10.000 Einwohnern. 1959-60, zum 150-jährigen Gedenken an den Tiroler Freiheitskampf von 1809 sowie zum 25-jährigen silbernen Priesterjubiläum des damaligen Bischofs Paulus Rusch, wurde eine neue vieleckige Kirche aus Stahlbeton nach Plänen des Innsbrucker Architekten Martin Eichberger gebaut; sie steht mittlerweile unter Denkmalschutz. Am 1.1.1960 erfolgte die Erhebung von St. Paulus zu einer selbstständigen Pfarre.
Einige Zeit besaß die Pfarrkirche zwei Pfeifenorgeln: 1967 baute Orgelbauer Walcker-Mayer aus Guntramsdorf in Niederösterreich ein kleines 5-registriges mechanisches Orgelpositiv mit freiem Holzpfeifenprospekt im Altarbereich der Kirche; 1979 wurde es an die evangelische Gemeinde in Kufstein weiterverkauft.
1970 errichtete der gleiche Orgelbauer Walcker-Mayer auf der Westempore der Pfarrkirche eine 25-registrige mechanische zweimanualige Schleifladenorgel mit Pedal. Die Disposition der Orgel stammt von Prof. Karl Benesch aus Innsbruck.
Über der in der Prospektfront zentral positionierten Spielanlage ist das große Brustwerk angeordnet, rechts davon befindet sich das Hauptwerk, links davon das Pedalwerk mit der sich im Prospekt befindenden Zartposaune 16‘, gefertigt aus Kupfer. Das Orgelgehäuse besteht aus einem mit Kunststoffplatten verkleideten Stahlgerüst. 2016-17 erfolgten Reinigungs- und Sanierungsarbeiten durch Orgelbau Edgar Töpfer aus Albertshofen in Bayern, dabei wurden u. a. auch die Windladen erneuert.
Theresienkirche Hungerburg
Erbauer: Gebr. Mauracher - Salzburg (A) Baujahr: 1928 Standort: 1928-1938 Canisianum der Jesuiten, Innsbruck; 1938 Transferierung auf die Theresienkirche Hungerburg, Südempore Instrument: 16-registrige zweimanualige Kegelladenorgel, freistehender Spieltisch Spieltraktur: pneumatisch Registratur: pneumatisch, Wippschalter
Auf der Hungerburg gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch keine Kirche. 1910 erfolgte die Gründung des Kirchenbauverein Mariabrunn: Eines der Gründungsmitglieder spendete dabei ein Grundstück zum Bau einer Kirche. Nach Einrichtung einer Notkirche 1927 konnte im Jahre 1932 die heutige Theresienkirche nach Plänen des jungen Architekten Willi Stigler gebaut werden. Die Wallfahrtskirche besitzt sehr bekannte Wandgemälde von Ernst Nepo (1935) und Max Weiler (1946).
Die Mauracher-Orgel, erbaut 1928 für die Aula im Canisianum der Jesuiten in Innsbruck, wurde 1938 auf die Musikempore der Theresienkirche auf der Hungerburg transferiert: Das Instrument besitzt einen Freipfeifenprospekt mit aus Zink gefertigten Prinzipalpfeifen.
Neue Pfarrkirche Hötting
Erbauer: Franz (II) Reinisch - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1892 Umbauten: 1931, Karl (II) Reinisch - Steinach a. Br., Tirol (A); 2014, Orgelbau Erler - Schlitters i. Zillertal, Tirol (A) Standort: 1892-1931 Pfarrkirche St. Jakob Innsbruck, Empore; seit 1931 Neue Pfarrkirche Hötting, Westempore Instrument: 33-registrige zweimanualige Kegelladenorgel, freistehender Spieltisch Spieltraktur: pneumatisch (mit Barkermaschine im Hauptwerk) Registratur: pneumatisch, Wippschalter
Hötting zählt so wie Wilten zu den ältesten Besiedlungen Innsbrucks. Die älteste Erwähnung einer Kirche in Hötting findet sich 1286. Ursprünglich gehörte Hötting zum Stift Wilten.
1853 wurde Hötting zu einer eigenen Pfarre erhoben. Die heutige Pfarrkirche Hötting (auch Neue Pfarrkirche Hötting genannt) wurde 1910-11 nach Plänen des Architekten Leopold Heiss errichtet. 1892 baute der Steinacher Orgelbauer Franz (II) Reinisch für die Innsbrucker Stadtpfarrkirche St. Jakob - unter Verwendung von altem Pfeifenmaterial aus der Humpel-Vorgängerorgel (Principal 16‘, Principal piano 8‘, Oktave 4‘, Rauschquint 22/3‘, Flauto amabile 8‘, Principalbaß 16‘ und Subbaß 16‘) - eine zweimanualige, mechanische Kegelladenorgel mit Barkermaschine.
1931 wurde die Orgel von seinem Sohn Karl (II) Reinisch in die Neue Pfarrkirche Hötting transferiert: Reinisch baute dort einen neuen Gehäuseunterteil mit neuen bronzierten Zink-Prospektpfeifen, zum Teil auch mit großen Rollbärten, sowie einen neuen freistehenden Spieltisch mit pneumatischer Registertraktur, arbeitete das Nebenwerk zu einem Schwellwerk um und ersetzte das Register Clarino 8‘ durch eine Vox coelestis 8‘.
2014 führte Orgelbau Erler aus Schlitters im Zillertal einen Umbau bzw. eine Generalsanierung durch, arbeitete dabei das offene Orgelgehäuse zu einem geschlossenen um und baute für einige Register des Hauptwerks Schwelljalousien in die Gehäusefront ein. Das Instrument besitzt noch originales Pfeifenmaterial aus der einstigen Humpel-Orgel aus dem Jahre 1725!
Alte Pfarrkirche Hötting
Erbauer: Erler Orgelbau - Schlitters im Zillertal, Tirol (A) Baujahr: 1997 Standort: Westempore Instrument: 9-registrige einmanualige Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Der erste Kirchenbau, erwähnt in Ablassbriefen von 1286 und 1293, ist nicht erhalten. Er konnte aber, nach Untersuchungen von Gräbern (über die C14-Methode) auf die Zeit von 690 bis 870 datiert werden. Im späten 12. Jahrhundert erfolgte ein Kirchenneubau, welcher im 15. Jahrhundert um einen gotischen Chor sowie ein neugebautes gotisches Langhaus erweitert wurde. Von 1750 bis 1752 wurde der Kirchenbau barockisiert und nach Westen hin verlängert.
Als die Kirche Anfang des 20. Jahrhunderts zu klein geworden und von 1909 bis 1911 etwas unterhalb der Kirche eine neue Pfarrkirche errichtet worden war, profanisierte man die alte Kirche und verkaufte einen Großteil des Inventars, die Kirche verfiel allmählich. Von 1947 bis 1958 wurde eine aufwändige Restaurierung durchgeführt, im Jahre 1951 konnte die Kirche wieder geweiht werden.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts musste die alte Pfarrkirche Hötting mit einer pneumatischen Zwillingsladen-Transmissionsorgel der Orgelbaufirma Cäcilia, Österreichische Orgelbau AG, auskommen, welche in der nationalsozialistischen Zeit von der bischöflichen Administratur in Innsbruck angekauft worden war: eine 6-registrige zweimanualige Orgel mit 5 Transmissionen.
2003 baute Erler Orgelbau aus Schlitters im Zillertal eine neue 9-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel mit Pedal auf die Westempore der alten Pfarrkirche. Das neu gebaute, barock konzipierte Orgelgehäuse erhielt eine marmorierte Fassung. Die Untertasten der Manualtastatur sind aus Ebenholz, die Obertasten mit einem Belag aus Knochen gefertigt.
Diözesanhaus Hötting
Erbauer: Christoph Enzenhofer - Bludesch, Vorarlberg (A) Baujahr: 1997 Standort: 1997-2023 Aula-Bühne; ab 2024 Fachreferentenbüro Kirchenmusik Instrument: 7-registrige zweimanualige Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
1997 baute Christoph Enzenhofer aus Bludesch in Vorarlberg ein 7-registriges zweimanualiges Instrument mit Flügeltüren und Keilbalganlage mit der Auflage des Auftragsgebers, sämtliche Pfeifen aus Holz zu fertigen. Die Aufstellung der Orgel erfolgte nicht - wie ursprünglich geplant - im Jungmannhaus, sondern auf der Bühne der Aula des Diözesanhauses (Neururerhaus).
Die Orgelweihe fand am 31.5.1997 im Rahmen der „Kirchenmusik-Literaturtagung 1997“ statt; im Programmfaltblatt zur Orgelweihe ist u. a. vermerkt, dass die Orgel ein Gehäuse aus Zedernholz besitzt und sämtliche Pfeifen aus Zypressenholz gefertigt sind. Ein kleine Ausnahme gibt es: Die vier kleinsten Pfeifen der Offenflöte 2‘ sind als einzige Pfeifen der Orgel aus Metall gebaut.
Rechts neben der Orgel steht die Balganlage mit zwei Keilbälgen: Diese können bei Bedarf auch händisch betätigt werden. Die Flügeltürenornamente gestaltete Brigitte Mumelter aus Hall in Tirol nach Gemälden aus alten Meßbüchern. 2024 wurde der Bereich der Aula-Bühne zum Fachrefenentenbüro für Kirchenmusik (Pastoraler Bereich SEELSORGE.leben, Pfarre und Gemeinschaft) umgebaut; nach Abschluss der Umbauarbeiten wurde die am alten Standort verbleibende Enzenhofer-Orgel von Orgelbau Linder aus Nussdorf am Inn gesäubert und neu gestimmt.
Priesterseminar Hötting, Seminarkirche
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1964 Standort: Südempore Instrument: 20-registrige zweimanualige Schleifladenorgel, Spielschrank mit verschließbaren Türen Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
1964 wurde die Diözese Innsbruck, welche zuvor von der Diözese Brixen als „Apostolische Administratur Innsbruck-Feldkirch“ verwaltet worden war, neu geschaffen. Das Priesterseminar der Diözese Innsbruck befindet sich im Stadtteil Hötting. Das heutige, unter Denkmalschutz stehende Bauensemble wurde 1955, ergänzend zum bestehenden Jungmannhaus, um das Neururerhaus und die Seminarkirche erweitert.
1964 baute Johann Pirchner (Reinisch-Pirchner) aus Steinach am Brenner auf der Empore der Seminarkirche eine neue 20- registrige mechanische Schleifladenorgel mit Hauptwerk, Rückpositiv und Pedal. Es war die erste von ihm gebaute Orgel mit Massivholz-Gehäuse.
Der Gehäuseentwurf stammt vom Innsbrucker Architekten Josef Menardi, die Disposition erstellte Prof. Karl Koch.2023 führte Martin Pirchner aus Steinach am Brenner an der Orgel eine Säuberung, Neuintonation sowie Neubelederung der Balganlage durch.
Privatwohnung Hötting
Erbauer: Hendrik Piet Kabout - (NL) / Donauwürth (D) Baujahr: um 1970 Standort: Wohnzimmer Instrument: 1-registriges Orgelpositiv (Gesellenstück) Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Der 2021 verstorbene niederländische Orgel- und Harmoniumbauer Hendrik Piet Kabout baute um 1970 ein kleines 1-registriges Orgelpositiv: Es handelte sich dabei um sein Gesellenstück.
Die Gehäuseteile sowie die Windlade errichtete er aus Eichen- und Kirschholz. Die Tasten fertigte er aus Obstholz und die insgesamt 42 gedeckten Orgelpfeifen (nach links aufsteigend in zwei hintereinanderliegenden Reihen) aus massivem Eichenholz.
2012 wurde die Kleinorgel vom Orgelbauer verkauft; sie befindet sich seither in Privatbesitz in einer Wohnung in Hötting.
Pfarrkirche Allerheiligen
Erbauer: Orgelbau Erler - Schlitters im Zillertal, Tirol (A) Baujahr: 2011 Standort: Altarraum, links Instrument: 22-registrige zweimanualige Schleifladenorgel mit Hauptwerk, Schwellwerk und Pedal, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Eine erste schriftliche Erwähnung eines Sakralbaus auf dem Gebiet der heutigen Pfarre Allerheiligen gibt es bereits von 1375. Die Pfarrkirche Allerheiligen wurde von 1963 bis 1965 nach Plänen des Tiroler Architekten Clemens Holzmeister gebaut. Die Einweihung der fertiggestellten Kirche erfolgte 1965.
Holzmeister berücksichtigte in seiner Planung keinen Platz für eine Pfeifenorgel; erst nach Bemühungen des damaligen Schuldirektors Walter Benesch wurde auf einer kleinen Musikempore eine zusätzliche Plattform für eine Orgel eingebaut. Aus Teilen einer vom Kirchenmusikalischen Institut Heidelberg als Geschenk erhaltenen elektrischen Übungsorgel (erbaut 1930 von Carl Heiss) errichtete Walter Benesch von 1963 bis 1967 auf einer rein elektrischen Kastenlade und zwei Zusatzladen eine 22- registrige dreimanualige Orgel mit Pedal.
Von 2008 bis 2011 wurde der Altarraum der Pfarrkirche im Sinne der Liturgiereform des 2. Vatikanischen Konzils umgestaltet. Im Zuge dieser Umbauarbeiten wurde auch das Orgelprovisorium von Walter Benesch entfernt. Orgelbau Erler aus Schlitters im Zillertal erhielt den Auftrag, eine neue zweimanualige 22-registrige mechanische Orgel zu bauen. Die Fertigstellung und Einweihung der Orgel, deren Gehäuse aus massivem Eichenholz besteht, erfolgte 2011.
Volksschule Allerheiligen
Erbauer: Walter Benesch, Josef Margreiter - Allerheiligen (A) Baujahr: 1975-77 Standort: Volksschule Allerheiligen, Orgelhalle Restauriert: 2001, zusammen mit Christian Erler, Schlitters (A) Instrument: 4-registriges einmanualiges mechanisches Orgelpositiv, Spielanlage mit verschließbarem Deckel Spieltraktur: mechanisch (mit Seilzugtraktur) Registratur: mechanisch, Registerzüge
1974-75 kam Direktor Walter Benesch von der Volksschule Allerheiligen anlässlich des „Jahres der musikalischen Bildung“ die Idee, als bleibende Erinnerung an die musikalischen Aktivitäten für die Volksschule ein Orgelpositiv zu bauen.
Bereits von 1975 bis 1977 setzte Benesch seine Vision in die Realität um: Mithilfe seines Schulwartes Josef Margreiter, der die gesamten Tischlerarbeiten ausführte und ein neues Gehäuse für das zu bauende Instrument errichtete, baute er in zweijähriger Freizeitarbeit ein 4-registriges einmanualiges Kegelladen-Orgelpositiv (ohne Pedal) mit Seilzugtraktur in der Orgelhalle der Volksschule.
Benesch verwendete dabei für das Orgelpositiv auch Teile (Reste) diverser ausrangierter Orgeln, u. a. von der einstigen Reinisch-Unterrichtsorgel des Tiroler Landeskonservatorium Innsbruck, erbaut 1929 (siehe S. 58). Die Prospektpfeifen in der Vorderfront des Orgelgehäuses setzte er nur aus optischen Gründen ein: Sie sind Attrappen und nicht klingend. Am 3.2.1978 erfolgte die feierliche Orgeleinweihung in der Volkschule Allerheiligen, die nun als einzige Pflichtschule in ganz Österreich ein Pfeifen-Orgelpositiv besaß.
2001 wurde das Instrument in Zusammenarbeit mit Orgelbauer Christian Erler aus Schlitters im Zillertall renoviert.
Wohnhaus Allerheiligen
Erbauer: unbekannt Baujahr: unbekannt: Gehäuse + Windlade - 16./17. Jh.(?) Standort: bis 1968 Annakapelle, Sillian in Osttirol (A); ab 1968 Wartha-Wohnhaus, Allerheiligen Umbauten: ca. 1800, Josef Volgger (?), Sillian in Osttirol (A); 1860, Peter Volgger (?), Sillian in Osttirol (A) Restauriert: 1968-70, Eigenarbeit von Dr. Marin Wartha; 2010, Orgelbau Erler, Schlitters im Zillertal, Tirol (A) Instrument: 5-registrige einmanualige mechanische Orgel Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Das 5-registrige einmanualige mechanische Orgelpositiv wurde für die Annakapelle in Sillian in Osttirol gebaut. Der Orgelbauer und die Erbauungszeit sind nicht bekannt. Die ältesten Teile der Orgel sind die noch erhaltene und später erweiterte Windlade mit einem ursprünglichen Tonumfang von F,G,A-g2,a2 mit 38 Tönen: sie stammen möglicherweise aus dem späten 16. oder beginnenden 17. Jahrhundert!
Um 1800 wurde die Orgel wahrscheinlich vom Sillianer Orgelbauer Josef Volgger umgebaut, dabei wurden die Windladen auf einen Tonumfang von C-c3 erweitert und eine neue Klaviatur gebaut.1860 erfolgte ein weiterer Umbau: es war vermutlich die erste Arbeit von Peter Volgger, der gerade die Orgelbauwerkstatt seines Vaters Johann Volgger übernommen hatte. Dabei wurde die Spielanlage auf die andere Seite der Orgel versetzt und ein angehängtes Kleinpedal mit dem Tastenumfang C-d0 dazugebaut.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfiel das Instrument zunehmend, die Metallpfeifen verschwanden zu einem unbekannten Zeitpunkt, Trakturteile wurden demoliert oder fehlten allmählich überhaupt, die Orgel wandelte sich so zu einer Ruine. 1968 erwarb Dr. Martin Wartha das Instrument, transferierte es in seine Privatwohnung in Allerheiligen und stellte es in den darauffolgenden zwei Jahren wieder her. Die fehlenden Pfeifen baute die Orgelbaufirma Reinisch-Pirchner aus Steinach am Brenner dazu.
2010 führte Wartha in Zusammenarbeit mit Orgelbauer Christian Erler aus Schlitters im Zillertal eine weitere Restaurierung durch und stellte das Positiv der Pfarrkirche Allerheiligen während des Orgelneubaus als Interimsorgel zur Verfügung. Seit November 2011 befindet sich das Instrument wieder in seinem Wohnhaus; es kann nicht besichtigt werden.
Pfarrvikariatskirche Kranebitten
Erbauer: Orgelbau Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 2007 Standort: Kirchenraum Instrument: 5-registrige einmanualige Schleifladenorgel, Orgelpositiv mit angehängtem Pedal Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
1989 errichtete man nördlich der alten Kirche eine Baracke als Notkirche und Seelsorge-Außenstelle der Pfarrkirche Allerheiligen. 2000 wurde Kranebitten zum Pfarrvikariat erhoben.2001-02 erfolgte nach den Plänen der Architekten Dipl. Ing. Dr. M. Illmer und Dipl. Ing. G. Tautschnig ein Kirchenneubau (Rundbau).
2007 baute Orgelbauer Martin Pirchner aus Steinach am Brenner im Kirchenraum ein neues 5-registriges einmanualiges Schleifladen-Orgelpositiv mit angehängtem Pedal. Die Gehäusegestaltung stammt von den beiden Kirchenarchitekten.
Ursulinenkloster, Hauskapelle
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1985 Standort: Hauskapelle, Altarraum Instrument: 7-registrige einmanualige Schleifladenorgel, Orgelpositiv mit angehängtem Pedal Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Der Ursulinenorden entstand 1612 als erster Schul- und Erziehungsorden für Mädchen; seit 1691 widmen sich die Ursulinen auch in Innsbruck dieser Aufgabe. 1832 baute der Zillertaler Orgelbauer Mathias Mauracher in der barocken Klosterkirche am Innrain eine neue Orgel.
Bereits 1875 ersetzte der Bozner Orgelbauer Josef Sies das Instrument durch eine 15-registrige, zweimanualige mechanische Schleifladenorgel mit Pedal. Das Instrument wurde mehrmals erweitert und umgebaut, unter anderem auch von Franz (II) Reinisch, der einen neuen freistehenden Spieltisch einbaute.
1971 entschloss sich der Konvent der Ursulinen für einen Neubau von Schule, Internat und Kloster in der Höttinger Au. Der Bau wurde nach Plänen des Innsbrucker Architekten Josef Lackner realisiert. 1978, nach Abschluss der Bauarbeiten, erfolgte der Umzug. Die Kirche am Innrain wurde profanisiert und im gleichen Jahr an die Raiffeisen Landesbank Tirol verkauft, die Orgel abgebrochen.
1985 baute Johann Pirchner aus Steinach am Brenner in die neu errichtete Klosterkapelle im Altarraum (seitlich links) ein 7- registriges Orgelpositiv mit angehängtem Pedal. Der Entwurf des Prospekt-Schleierbretts stammt von Josef Lackner. Die Orgelweihe fand am 11. Oktober 1985 statt.
Pfarrkirche Petrus Canisius
Erbauer: Walcker-Mayer - Guntramsdorf, Niederösterreich (A) Baujahr: 1974 Standort: Altarraum Instrument: 10-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank, freier Prospekt Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Die Pfarrkirche Petrus Canisius, ein flach gedeckter, turmloser Bau, wurde von 1968 bis 1972 nach Plänen des Innsbrucker Architekten Horst Herbert Parson erbaut und ist dem heiligen Petrus Canisius, dem Patron der Diözese Innsbruck, geweiht. Im Obergeschoss der Kirche befindet sich der Kirchenraum, der über vier Eckeingänge zugänglich ist, im Untergeschoss ist der Pfarrsaal untergebracht.
Bereits 1968 war in dem zur Pfarre Maria Hilf gehörendem Gebiet rund um die Kirche, am Rande des Hochhausviertels der Höttinger Au, das Pfarrvikariat Petrus Canisius errichtet worden. 1978 erhob der damalige Bischof Reinhold Stecher das Vikariat zur eigenständigen Pfarre.
Usprünglich plante man den Ankauf einer elektronischen Orgel; 1974 wurde jedoch nach einem Gehäuseentwurf des Kirchenarchitekten eine 10-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel von der Orgelbaufirma Walcker-Mayer gebaut.
Das Instrument besitzt einen freistehenden Prospekt aus teils stummen Orgelpfeifen, die restlichen Pfeifen sind hinter Holzgittern untergebracht.
Pfarrkirche Mühlau
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1983 Standort: Südempore Instrument: 17-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
1432 wurde in Mühlau eine erste Kirche geweiht. Der barocke Kirchenraum entstand 1748-50 nach Plänen von MathiasUmhauser. 1851-1859 erfolgte eine Umgestaltung im neoromanischen Stil.
1843 baute Johann Strobl, geboren in Münster in Tirol, eine neue mechanische Schleifladenorgel. Bereits 1929 folgte ein erneuter, mittlerweile pneumatischer zweimanualiger 19-registriger Orgelneubau durch die Steinacher Orgelbauwerkstatt Franz (II) Reinisch.
Das heutige Instrument baute 1983 die Steinacher Nachfolgefirma Reinisch-Pirchner als mechanische, zweimanualige 17-registrige Schleifladenorgel. Das Gehäuse sowie die Schleierbretter sind aus massivem Eichenholz gefertigt. Die Untertasten bestehen aus Beinbelag, die Obertasten aus Ebenholz.
Schloss Mühlau, Kapelle Mariahilf
Erbauer: Augustin Simnacher - Tussenhausen, Bayern (D) Baujahr: 1725 Standort: Nordempore (Brüstung) Instrument: 8-registrige einmanualige mechanische Brüstungsorgel mit Pedal, hinterspielig Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerschieber
Schloss Mühlau, vor Jahrzehnten noch Schloss Sternbach genannt, besteht aus den beiden sich nebeneinander befindenden ehemaligen Ansitzen Grabenstein und Rizol, welche nur durch eine schmale Durchfahrtstraße getrennt sind.
1707 bzw. 1714 kaufte Freiherr Franz Andreas Wenzl von Sternbach die beiden Ansitze Rizol und Grabenstein und legte sie im Zuge von Umbauarbeiten zusammen. Im Ansitz Grabenstein wurden ursprünglich Rüstungen hergestellt, welche schon im15. Jahrhundert europaweit verkauft wurden. 1720 entstand die relativ große barocke Schlosskapelle Mariahilf mit Deckenfresken und Malereien des Tiroler Malers Kaspar Waldmann: Sie bildet den südlichen Abschluss der Anlage.
1725 baute Augustin Simnacher aus Tussenhausen in Bayern zentral mittig auf die Empore eine neue 8-registrigeeinmanualige Brüstungsorgel mit hinterspieliger Spielanlage. 1738 überstand die Orgel einen Brand in der Kapelle, anscheinend ohne Beschädigungen. Im 20. Jahrhundert erfolgte der Einbau eines Elektromotors für die Windversorgung. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts häuften sich die Altersgebrechen des Instruments, zudem wurde die Orgel stark vom Holzwurm befallen.
2024 führte Orgelbauer Martin Pirchner aus Steinach am Brenner eine Reparatur am Magazinbalg durch. Das spielbare, jedoch restaurierungsbedürftige Instrument gilt heute - vor allem auch durch den nahezu unverändert erhaltenen Zustand von 1725 - als herausragendes und seltenes süddeutsches Klangdenkmal des frühen 18. Jahrhunderts. Da sich Schloss Mühlau im Privatbesitz befindet, kann die Orgel in der Schlosskapelle Mariahilf nicht besichtigt werden.
Karmel St. Josef und St. Theresa, Klosterkirche
Erbauer: Andrea Zeni - Tesero, Trentino (I) Baujahr: 2003 Standort: Kirchenraum, seitlich Instrument: 7-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel, freistehender Spieltisch (op. 19) Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
1846 wurde der „Karmel St. Josef“, damals noch inmitten von Mais- und Ackerfeldern in der heutigen Adamgasse gegründet. 1858 wurde in unmittelbarer Nähe der Innsbrucker Hauptbahnhof eröffnet: Der Stadtteil Wilten entwickelte sich in den darauffolgenden Jahrzehnten rasant. Bereits Anfang 20. Jahrhundert dachte der Orden so über eine Verlegung des Klosters nach.
Erst im Jahr 2003 gelang die Klosterverlegung: Am 27.6.2003 weihte der damalige Tiroler Bischof Alois Kothgasser das neu gebaute Kloster in Mühlau ein. Das ehemalige Kloster in der Adamgasse wurde abgerissen, die Klosterkirche blieb bestehen. 1989 wurde im damaligen Karmel in der Adamgasse eine einmanualige mechanische 6-registrige Orgel mit Pedal von Orgelbau Gebrüder Mayer aus Feldkirch in Vorarlberg errichtet.
Im Zuge des Klosterumzuges wurde die Mayer-Orgel, welche die Schwestern auch als zu laut und nicht ideal für die Begleitung des Chorgebetes empfanden, 2003 verkauft. Sie befindet sich mittlerweile in einem Vortragsraum der Musikschule Innsbruck. In der neu gebauten Klosterkirche in Mühlau baute der italienische Orgelbauer Andrea Zeni aus Tesero im Trentino (als sein op. 19) im gleichen Jahr eine neue, 7-registrige mechanische Schleifladenorgel; die Gehäusegestaltung stammt vom Künstler Leo Zogmayer - der auch für die Innengestaltung der Klosterkirche verantwortlich war.
Pfarrkirche Arzl
Erbauer: Orgelbau Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 2004 Standort: Westempore Instrument: 20-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Die erste schriftliche Erwähnung eines Sakralbaus in Arzl stammt aus dem Jahre 1237; der früheste archäologisch erschlossene Bau stammt vermutlich bereits aus dem 8. Jahrhundert.
1480 erfolgte die Weihe einer neu gebauten gotischen Kirche; von 1735-37 wurde sie barock umgebaut. Arzl, das ursprünglichzur benachbarten Pfarre Thaur gehörte, wurde 1891 zur eigenständigen Pfarre erhoben.
1947 baute die Orgelbaufirma Karl Reinisch‘s Erben aus Steinach am Brenner unter Verwendung von Pfeifenmaterial aus im Krieg zerstörter Orgeln als erste neu gebaute Orgel nach dem II. Weltkrieg eine neue zweimanualige pneumatische 14-registrige Kegelladenorgel mit freistehendem Zinkpfeifenprospekt.
2004 erfolgte ein zweimanualiger mechanischer 20-registriger Neubau durch die Nachfolgefirma Orgelbau Pirchner.
Kalvarienbergkirche Arzl
Erbauer: unbekannt Baujahr: unbekannt (ca. 1800-20) Rekonstruiert: 2000, Thomas Sittler - Biberwier, Außerfern (A) Standort: Nordempore Instrument: 5-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel mit angehängtem Pedal, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerschieber
Rund 100 m über dem Inntal erhebt sich der Arzler Kalvarienberg; er gilt zusammen mit dem Kirchlein als Wahrzeichen von Arzl und ist auch im Stadtwappen abgebildet. Der Hügel war sehr wahrscheinlich schon in der Bronzezeit und im Frühmittelalter bebaut. 1664 wurde die Kalvarienbergkirche erbaut, 1665 wurden die Kreuzwegstationen errichtet. Mittlerweile steht die gesamte Anlage unter Denkmalschutz.
Die älteste schriftliche Überlieferung von einem Instrument in der Kalvarienbergkirche stammt aus dem Kircheninventar vom 22.7.1807: „Ein kleines und schlechtes Örgele...“. Ob es sich dabei schon um das bis heute erhaltene 5-registrige Orgelpositiv mit angehängtem Pedal und kurzer Bassoktav handelt, ist fraglich. Es könnte von Josef (II) Fuchs aus Gries am Brenner oder vielleicht auch von Andreas Mauracher aus Fügen im Zillertal, der auch ein geschickter Tischler war, geschaffen worden sein.
Im Laufe der beiden darauffolgenden Jahrhunderte wandelte sich das Orgelpositiv zu einem unspielbaren Instrument. Mit der Zeit verschwanden auch sämtliche Orgelpfeifen aus der Orgel. Nachdem bei dieser Orgelruine Orgelgehäuse, Windladen, Orgelmechanik mit Traktur, Klaviatur, Registratur und Balganlage noch original vorhanden waren, entschloss man sich, die Orgel wieder auf den Erbauungszustand zu rekonstruieren. Den Auftrag dazu erhielt Orgelbauer Thomas Sittler aus Biberwier im Außerfern in Tirol, der im Jahre 2000 die Orgel gewissermaßen wieder zum Leben erweckte.
Sittler rekonstruierte das Pfeifenwerk entsprechend den Vorgaben der Windlade und den Platzverhältnissen im Gehäuse: Er baute die Register Gedeckt 8‘ und Flöte 4‘ aus Holz, die Register Principal 4‘ ab c0 (im Prospekt), Octav 2‘ sowie Quint 11/3‘ aus Zinn und stellte somit die ursprüngliche Disposition wieder her. Außerdem erneuerte er die alte Balganlage und baute zur Versorgung der beiden Keilbälge, alternativ zum Handbetrieb über Stricke, einen Elektromotor mit Schleudergebläse ein. Aufgrund von Intonationsschwächen (vor allem bei den tiefen Prospektpfeifen), starken Windverlusten bei händischem Aufziehen der Bälge sowie unzureichender Wurmbekämpfung, festgestellt von der Diözesanen Orgelkommision Innsbruck sowie vom Orgelsachverständigen Prof. Heribert Metzger aus Salzburg, musste das rekonstruierte Instrument vom Orgelbauer mehrmals nachgearbeitet werden.
Pfarrkirche Amras
Erbauer: Karl Reinisch‘s Erben - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1960 Standort: Westempore Instrument: 15-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Bereits 1221 wird in Amras urkundlich eine dem Hl. Pankratius und Bischof Zeno geweihte Kirche erwähnt; seit 1259 wird sie von den Prämonstratensern vom Stift Wilten betreut. 1489 wurde nach ihrer Fertigstellung eine neue, spätgotischen Kirche eingeweiht.
1840 baute Franz (I) Reinisch aus Steinach am Brenner eine einmanualige, 12-registrige mechanische Schleifladenorgel. 1910 stellte sein Sohn Franz (II) Reinisch eine neue einmanualige 10-registrige pneumatische Orgel ins bestehende Gehäuse. 1960 erfolgte ein weiterer Orgelneubau ins alte Gehäuse durch die Nachfolgefirma Karl Reinisch‘s Erben: eine 15-registrige mechanische zweimanualige Schleifladenorgel.
Die alte, 10-registrige einmanualige pneumatische Taschenladenorgel konnte nach Arzl im Pitztal verkauft und in die dortige Expositurkirche Wald im Pitztal transferiert werden.
Anlässlich einer Renovierung der Pfarrkirche im Jahr 1968-69 wurde die Empore mitsamt der Orgel tiefer gelegt und vergrößert, das 1960 bewusst nicht als Stilkopie gebaute Rückpositiv mit üppigen goldenen Schleierbrettern ausgestattet und das Hauptgehäuse sowie das Rückpositiv mit einer Marmorierung, entsprechend der Optik der Altäre in der Kirche, versehen. Nach einem Kirchenbrand am 2.12.1970 musste 1971 eine erneute Restaurierung der Pfarrkirche und Orgel erfolgen - durch die große Hitzeentwicklung waren sogar Orgelpfeifen geschmolzen.
Pfarrkirche Vill
Erbauer: Franz (I) Reinisch - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: vor 1850 Standort: Südwestempore Instrument: 11-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Bereits im Jahre 1397 wurde die Kirche in Vill erstmals urkundlich erwähnt. Der Kirchenbau wurde einheitlich gotisch errichtet; 1791-92 erfolgte eine Umgestaltung des Innenraums im spätbarocken Stil.
In den späten 1840er Jahren baute der Steinacher Orgelbauer Franz (I) Reinisch eine 11-registrige einmanualige, mechanische Schleifladenorgel mit Pedal auf die Westempore, welche dieselbe Disposition wie die ursprüngliche Orgel in der Pfarrkirche Igls aufwies. Nach Ende des 1. Weltkriegs wurden die im Krieg beschlagnahmten Prospektpfeifen durch Zinkpfeifen ersetzt und im Dachboden eine Balganlage mit Magazinbalg und Elektromotor untergebracht.
Im Zuge einer von 1970 bis 1973 durchgeführten Innen- und Außenrestaurierung wurde 1973 auch die Orgel von der Steinacher Orgelbaufirma Reinisch-Pirchner sorgfältig restauriert. Pirchner baute u. a. Zinn-Prospektpfeifen ein und errichtete eine neue Balganlage unter dem erhöhten Emporenboden neben der Orgel.
2016 erfolgte eine erneute Innenrestaurierung und Turmdachsanierung; dabei wurde auch eine Säuberung und Neuintonation der Orgel durch Orgelbau Pirchner durchgeführt und die ursprüngliche pastellfarbige Leimfarbenfassung des Orgelgehäuses mit mehrstufigem zarten Grün und zartem Rosa wieder hergestellt.
Pfarrkirche Igls
Erbauer: Franz (I) Reinisch - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1850 Umbau: 1961-62, Reinisch-Pirchner, Steinach a. Br. (A) Standort: Südwestempore Instrument: 15-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Der erste schriftliche Beleg für eine Kirche stammt aus dem Jahre 1286. Nach einem spätgotischen Umbau wurde die Kirche 1479 dem Hl. Ägidius geweiht. Von 1700 bis 1705 baute man die Kirche barock um; die Fresken und die Inneneinrichtung stammen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
1891 wurde Igls zusammen mit Vill zu einer gemeinsamen Pfarre erhoben, welche bis heute von den Prämonstratensern aus Wilten betreut wird. Seit der Eingemeindung zu Innsbruck im Jahre 1942 ist Igls ein Stadtteil von Innsbruck.
1849 baute Franz (I) Reinisch unter Mithilfe seines Bruders Johann Benedikt Reinisch eine neue 11-registrige einmanualige Schleifladenorgel mit Pedal (ausgeführt mit der gleichen Bauweise und Disposition wie die Orgel in der Pfarrkirche des Nachbarortes Vill).
1961-62 wurde das Instrument, u. a. auf besonderes Betreiben des damaligen Chorleiters und Organisten Hans Erhardt, von Johann Pirchner aus Steinach am Brenner einschneidend umgebaut: Dabei wurde auch die kurze Bassoktav der Manual- und Pedal-klaviatur chromatisch ausgebaut und die Orgel um ein zweites 4-registriges Manualwerk erweitert. Ebenso wurden die Zink-Prospektpfeifen durch neue aus Zinn ersetzt.
Von 1960 bis 1968 erfolgte eine Innenrenovierung; dabei wurde das Orgelgehäuse mit einer neuen marmorierten Fassung versehen.
Wallfahrtskirche Heiligwasser
Erbauer: Johann Georg Gröber - Innsbruck, Tirol (A) Baujahr: unbekannt (ca. 1820-50) Restauriert: 2004, Orgelbau Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Standort: Südwestempore Instrument: 6-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel mit Pedal, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerhebel
Oberhalb Igls liegt auf 1234 m ü. M. der Wallfahrtsort Heiligwasser. Der Legende nach suchten zwei Bauernsöhne im Jahr 1606 nach ihrem verlorenen Vieh, als ihnen die Muttergottes erschien und den Weg zu einer Quelle zeigte, bei der sich das Vieh befand.
Nachdem 1651 an der gleichen Stelle ein taubstummes Kind geheilt wurde, erlaubte der damalige Bischof von Brixen, eine hölzerne Kapelle zu errichten, welche rasch zum Ziel von Wallfahrern wurde. 1661 erfolgte auf Anweisung des Wiltener Abtes Dominikus Löhr der Bau der heutigen Wallfahrtskirche. Ein Pilgerweg, auf dem sich fünf Kapellen mit Darstellungen des freudenreichen Rosenkranzes befinden, führt seither von Igls zur Wallfahrtskirche.
Zu einem unbekannten Zeitpunkt (ca. 1820-50) baute der Innsbrucker Orgelbauer Johann Georg Gröber eine 6-registrige mechanische einmanualige Schleifladenorgel. Das Instrument besitzt keinen Pfeifenprospekt, wurde ursprünglich vermutlich als Hausorgel erbaut und möglicherweise erst zu einem späteren Zeitpunkt auf die Empore der Wallfahrtskirche Heiligwasser transferiert. Das Pedal ist ohne eigene Pedalkoppel fix ans Manual gekoppelt.
Das Subbass 16‘-Register wurde sehr wahrscheinlich von Orgelbauer Mathias Weber aus Oberperfuß erst später dazu gebaut (Die Handbeschriftungen an den Subbass-Holzpfeifen weisen eine auffallende Ähnlichkeit mit den Beschriftungen an der von Mathias Weber 1844 gebauten Orgel in der Pfarrkirche St. Laurentius in Bichlbach bei Reutte auf). Die Orgel besaß ursprünglich auch das Register Phisharmonika 8‘ mit durchschlagenden Zungen für das Pedal, welche jedoch zu einem unbekannten Zeitpunkt entfernt wurden.
2004 erfolgte eine Restaurierung durch Orgelbau Pirchner aus Steinach am Brenner. Dabei wurden auch ein neuer Orgelmotor und eine neue Pedalwindlade eingebaut; auf die Rekonstruktion der Zungen für das Register Phisharmonika 8‘ wurde bei der Restaurierung verzichtet.
Orgeln außerhalb von Innsbruck

Pfarrkirche Bings
Pfarrkirche Bings. Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Karl Reinisch‘s Erben - Steinach a. Br. Tirol (A) Baujahr: 1950-51 Standort: 1950-1957 Jugendheim St. Nikolaus, Innsbruck; 1957-1991 Pfarrkirche Bings, Bludenz (Vbg.) Instrument: 8-/14-registrige zweimanualige Schleifladenorgel, 1990er abgebrochen, ersetzt durch eine Digitalorgel Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Pfarrkirche Landeck
Pfarrkirche Landeck. Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Reinisch Pirchner - Steinach a. Br. Tirol (A) Baujahr: 1967-68 Standort: bis 2016 Propstei-Wohnung Msgr. Peter Webhofer; seit 2016 Pfarrkirche Landeck, Altarbereich rechts Instrument: 3-registriges Schleifladen-Orgelpositiv Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerschieber

Landesmusikschule Imst
Landesmusikschule Imst. Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Karl Reinisch‘s Erben - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1956 Standort: 1956-1964 Priesterseminar Hötting; ab 1964 Innsbrucker Domchors, Probelokal; ab 2008 Landesmusikschule Imst, Vortragssaal Instrument: 12-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Expositurkirche Wald im Pitztal
Expositurkirche Wald im Pitztal. Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Franz (II) Reinisch - Steinach a. Br. (A) Baujahr: 1905 Standort: 1905-1960 Westempore Pfarrkirche Amras; seit 1960 Expositurkirche Wald im Pitztal, Empore Restauriert: 2003, Orgelbau Späth AG, Rapperswil (CH) Instrument: 10-registrige einmanualige pneumatische Taschenladenorgel, freistehender Spieltisch Spieltraktur: pneumatisch Registratur: pneumatisch, Registerwippen

Kaplaneikirche Niederthai
Kaplaneikirche Niederthai. Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Orgelbau Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1999 Standort: 1999-2007 Dom zu St. Jakob, Altarbereich rechts; 2009-2010 Musikschule Unterland - Auer, Südtirol; 2010-2012 Landesmusikschule Ötztal - Umhausen; seit 2012 Kaplaneikirche Niederthai, Ötztal Instrument: 4-registrige einmanualige Schleifladen-Truhenorgel mit angehängtem Pedal Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerschieber

Pfarrkirche Ötztal-Bahnhof
Pfarrkirche Ötztal-Bahnhof. Zum Einblenden klicken.
Erbauer: E. F. Walcker & Cie - Ludwigsburg, Stuttgart (D) Baujahr: 1955 Umbau: 2015-16, Rösel Orgelbau- Saalfeld, Thüringen (D) Standort: 1955-2015 Stadtsaal (Innsbruck), Empore; seit 2017 Pfarrkirche Ötztal-Bahnhof, Südempore Instrument: opus 3.340, 46-registrige dreimanualige, mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: elektrisch, Registerzüge

Landeskrankenhaus Hochzirl, Hauskapelle
Landeskrankenhaus Hochzirl, Hauskapelle. Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Josef Mertin - Wien (A) Baujahr: 1982 Standort: 1982-2012 Wohnung, Musikzimmer; ab 2012 Hauskapelle Landeskrankenhaus Hochzirl Instrument: 6-registrige einmanualige mechanische Orgel Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Heilig Geist-Kirche, Matrei am Brenner
Heilig Geist-Kirche, Matrei am Brenner . Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Anton Behmann - Schwarzach, Vorarlberg (A) Baujahr: 1895 Standort: 1895-1906 Hauskapelle der Evangelischen Gemeinde (zuvor Hauskapelle der k.k. Normalschule); seit 1907 Matrei am Brenner, Hl. Geist-Kirche (A) Instrument: 9-registrige zweimanualige mechanische Kegelladenorgel, freistehender Spieltisch (op. 54) Spieltraktur: mechanisch Registratur: Registerzüge

Pfarrkirche St. Franziskus, Schönegg-Hall
Pfarrkirche St. Franziskus, Schönegg-Hall. Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1996 Standort: 1996-2005 Stiftskirche Wilten, Altarraum; seit 2005 Altarraum Pfarrkirche Schönegg-Hall, Altarraum Instrument: 15-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Lindenkirche St. Georgenberg
Lindenkirche St. Georgenberg. Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Reinisch Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: ca. 1990 Standort: ca. 1990-2022 Zentrum 107, Innstraße 107, Innsbruck; seit 2022 Lindenkirche St. Georgenberg, Stans Instrument: 1-registriges einmanualiges, mechanisches Schleifladen-Orgelpositiv, transponierbar Spieltraktur: Stechermechanik Registratur: nicht vorhanden

Johanneskirche, Kufstein
Johanneskirche, Kufstein. Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Walcker-Mayer - Guntramsdorf, Niederösterreich (A) Baujahr: 1967 Standort: 1967-1979, Pfarrkirche St. Paulus, Altarraum; seit 1979 Johanneskirche Kufstein, Altarraum Instrument: 5-registrige einmanualige, mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Filialkirche Siebending
Filialkirche Siebending. Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Karl Reinisch‘s Erben - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1961 Standort: 1961-1999 Landeskrankenhaus Innsbruck, Kapelle; seit 1999 Filialkirche Siebending, St. Andrä im Lavanttal (Kärnten), Empore Instrument: 12-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Stift Schlägl
Stift Schlägl . Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Orgelbau Metzler & Söhne - Dietikon, Zürich (CH) Baujahr: 1973 Standort: 1973-1985 Höttinger Au, Wohnung; seit 1985 Stift Schlägl (OÖ), Musikzimmer Instrument: 3-registriges einmanualiges Schleifladen-Positiv Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Pfarrkirche Stephanshart
Pfarrkirche Stephanshart. Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Gregor Hradetzky - Krems, Niederösterreich (A) Baujahr: 1962-64 Standort: 1964-2005 2. Westempore; seit 2007 Pfarrkirche Stephanshart, Amstetten (NÖ) Instrument: 40-registrige viermanualige mechanische Schleifladenorgel, angebauter Spieltisch Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Pfarrkirche Breitenfeld
Pfarrkirche Breitenfeld . Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Rieger Orgelbau - Jägerndorf (Krnov), Schlesien (CZ) Baujahr: 1931 (op. 2.500) Standort: 1931-1998 Dom zu St. Jakob, Empore; seit 2001 Pfarrkirche Breitenfeld, Josefstadt Wien Umbau: 1999-2001, Orgelbau Peter Maria Kraus, Lessach (A) Instrument: 66-registrige viermanualige pneumatische Orgel, freistehender Spieltisch Spieltraktur: elektropneumatisch Registratur: elektropneumatisch, Registerwippen

Kunsthistorisches Museum Wien
Kunsthistorisches Museum Wien. Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Servatius Rorif - Innsbruck (A) Baujahr: ca. 1564-69 Standort: ursprünglich Schloß Ambras; heute Kunsthistorisches Museum Wien Instrument: 18-registriges einmanualiges, mechanisches Claviorganum (mit mehreren Effektregistern) Spieltraktur: mechanisch, Stechermechanik Registratur: mechanisch, Registerzüge

Warschau (Privat)
Warschau (Privat). Zum Einblenden klicken.
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1986 Standort: 1986-2021 mobil / Universitätsstraße 1; seit 2023 in Warschau, Polen, Privatbesitz Instrument: 4-registriges einmanualiges mechanische Schleifladen-Truhenorgel, transponierbar Spieltraktur: Stechermechanik Registratur: mechanisch, Registerschieber
Pfarrkirche Bings
Erbauer: Karl Reinisch‘s Erben - Steinach a. Br. Tirol (A) Baujahr: 1950-51 Standort: 1950-1957 Jugendheim St. Nikolaus, Innsbruck; 1957-1991 Pfarrkirche Bings, Bludenz (Vbg.) Instrument: 8-/14-registrige zweimanualige Schleifladenorgel, 1990er abgebrochen, ersetzt durch eine Digitalorgel Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Die Kirchenmusikschule Innsbruck wurde 1948 als Kirchenmusikalische Abteilung der damaligen Städtischen Musikschule Innsbruck gegründet. Aufgrund des regen Zuspruchs durch interessierte Kirchenmusikschüler und gleichzeitig unmögliche Orgel-Übungsmöglichkeiten entschloss sich der damalige Bischof Paulus Rusch (damals auch apostolischer Administrator von Innsbruck-Feldkirch), für die Kirchenmusikschule Innsbruck eine kleine mechanische Orgel als Unterrichts- und Übungsinstrument anzuschaffen.
1949 erfolgte die Auftragserteilung an die Steinacher Orgelbauwerkstatt Karl Reinisch’s Erben, welche 1950-51 im Jugendheim St. Nikolaus in Innsbruck eine neue zweimanualige, mechanische Schleifladen-Orgel mit Pedal, zunächst mit 8 Registern sowie 6 Leerschleifen (für den späteren Einbau von 6 weiteren Registern), aufstellte.
Ab 1956 wurde der Orgelunterricht für die Kirchenmusikschüler an einer neu gebauten 12-registrigen mechanischen Schleifladenorgel aus der gleichen Orgelbauwerkstatt in den gerade fertiggestellten neuen Räumlichkeiten des Höttinger Priesterseminars für Innsbruck und Feldkirch (Neururerhaus) durchgeführt. 1957 erfolgte der Verkauf der alten Orgel an die Pfarre Bings bei Bludenz in Vorarlberg. Noch im gleichen Jahr stellte der Dornbirner Orgelbauer Edmund Hohn das Instrument auf der Empore der neu gebauten und gerade fertiggestellten Pfarrkirche Bings auf und setzte die bereits 1951 vorgesehenen 6 Register ein. Die Orgelweihe fand am 6.7.1957 statt. 1991, ein Jahr vor der letzten Innenrestaurierung der Pfarrkirche Bings, wurde das Instrument abgebrochen und durch eine elektronische Orgel ersetzt.
Von der einstigen Orgel existieren nur noch 40 Prospektpfeifen vom Principal 4‘ und 13 Holzpfeifen vom Gedeckt 8‘: Sie wurden als Atrappe an der Vorderseite eines neuen kleinen mehrteiligen Gehäuses, aufgehängt an der Kirchenrückwand, angebracht und verbergen so die im Gehäuse positionierten Lautsprecherboxen.
Pfarrkirche Landeck
Erbauer: Reinisch Pirchner - Steinach a. Br. Tirol (A) Baujahr: 1967-68 Standort: bis 2016 Propstei-Wohnung Msgr. Peter Webhofer; seit 2016 Pfarrkirche Landeck, Altarbereich rechts Instrument: 3-registriges Schleifladen-Orgelpositiv Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerschieber
1967-68 baute die Steinacher Orgelbauwerkstatt Reinisch-Pirchner für Msgr. Peter Webhofer (1. Domkapellmeister von 1964-72 am Dom zu St. Jakob Innsbruck) ein neues 3-registriges mechanisches Schleifladen-Orgelpositiv mit verschließbaren Flügeltüren aus Nadelholz und stellte es in seiner Propstei-Wohnung am Domplatz in Innsbruck auf.
1978 bemalte der Tiroler Maler und Bildhauer Wolfram Köberl die beiden Flügeltüren der Orgel. Im gleichen Jahr baute die Steinacher Orgelbauwerkstatt Reinisch-Pirchner zum Orgelpositiv noch ein angehängtes Pedal dazu. Die Manualklaviatur besitzt einen Tastenumfang von genau vier Oktaven; die Untertasten sind mit Buchsbaum belegt, die Obertasten mit Rindsknochen; die 18 Pedaltasten sind aus massivem Eichenholz gefertigt.
2016, nach dem Tod Msgr. Peter Webhofers, wurde die Orgel von der Innsbrucker Dompfarre als Leihgabe der Pfarre Landeck zur Verfügung gestellt, in die Pfarrkirche Landeck transferiert und dort an der rechten Seite im Altarbereich (neben dem Eingang in die Sakristei) aufgestellt.
Landesmusikschule Imst
Erbauer: Karl Reinisch‘s Erben - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1956 Standort: 1956-1964 Priesterseminar Hötting; ab 1964 Innsbrucker Domchors, Probelokal; ab 2008 Landesmusikschule Imst, Vortragssaal Instrument: 12-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Das Instrument wurde 1956 von der Steinacher Orgelbaufirma Karl Reinisch‘s-Erben als Unterrichts- und Übungsorgel für das Priesterseminar in Hötting gebaut. Die Disposition für die ursprünglich 12-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel mit Pedal stammt vom damaligen Kirchenmusikreferenten Hans-Joachim Neumann.
1964, nach Fertigstellung der größeren Orgel in der Kirche des Priesterseminars, transferierte man das Instrument ins Probelokal des Innsbrucker Domchores. Zu einem unbekannten Zeitpunkt erfolgte der Abbau und die Einlagerung der Orgel. 2008 stellte man das Instrument der Landesmusikschule Imst zur Verfügung; Martin Pirchner aus Steinach am Brenner adaptierte es für den neuen Standort, baute dabei ein neues Orgelgehäuse aus Fichtenholz sowie ein Regal 8‘ für das Brustwerk dazu. Die Orgelweihe in Imst erfolgte am 14.11.2008.
Expositurkirche Wald im Pitztal
Erbauer: Franz (II) Reinisch - Steinach a. Br. (A) Baujahr: 1905 Standort: 1905-1960 Westempore Pfarrkirche Amras; seit 1960 Expositurkirche Wald im Pitztal, Empore Restauriert: 2003, Orgelbau Späth AG, Rapperswil (CH) Instrument: 10-registrige einmanualige pneumatische Taschenladenorgel, freistehender Spieltisch Spieltraktur: pneumatisch Registratur: pneumatisch, Registerwippen
Die 10-registrige einmanualige pneumatische Taschenladenorgel mit Pedal und freistehendem Spieltisch wurde von Franz (II) Reinisch ursprünglich im Jahr 1905 für die Pfarrkirche Amras erbaut. 1960 erfolgte in der Pfarrkirche Amras ein 15-registriger zweimanualiger mechanischer Orgelneubau durch die Nachfolgefirma Karl Reinisch‘s Erben. Die alte, noch gut funktionierende pneumatische 10-registrige Reinisch-Orgel wurde ohne Orgelgehäuse in die Expositurkirche Wald im Pitztal transferiert.
2003 führte Orgelbau Späth aus Rapperswil in der Schweiz eine sorgfältige und umfangreiche Restaurierung des Instruments durch, welches u. a. einen starken Wurmbefall aufwies und sich in einem fast unspielbaren Zustand befand.
Dabei wurden auch die aus Zinkblech hergestellten Prospektpfeifen neu gespritzt, der bisherige Freiprospekt mit einem Orgelgehäuse versehen und die gesamte Orgel neu intoniert. Im Instrument befinden sich noch einige Pfeifen der ehemaligen Herz-Hauptorgel der Stiftskirche Wilten: darunter auch 4‘- Prospektpfeifen vom ehemaligen Rückpositiv.
Kaplaneikirche Niederthai
Erbauer: Orgelbau Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1999 Standort: 1999-2007 Dom zu St. Jakob, Altarbereich rechts; 2009-2010 Musikschule Unterland - Auer, Südtirol; 2010-2012 Landesmusikschule Ötztal - Umhausen; seit 2012 Kaplaneikirche Niederthai, Ötztal Instrument: 4-registrige einmanualige Schleifladen-Truhenorgel mit angehängtem Pedal Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerschieber
Das 4-registrige Truhenpositiv wurde 1999 von der Orgelbaufirma Pirchner in Steinach a. Br., Tirol, erbaut und war als Interims-Orgel während des Neubaus der Pirchner-Domorgel im Altarbereich des Innsbrucker Doms aufgestellt. Die Kleinorgel verblieb bis 2007 als Zweitinstrument in der Dompfarrkirche.
Von 2009-10 diente das Instrument als Interims-Unterrichtsorgel in der Musikschule Unterland, Schulstelle Sepp Thaler, Auer in Südtirol (während dem Bau der 14-registrigen Pirchner-Unterrichtsorgel für die Musikschule in Auer). Martin Pirchner baute dafür ein angehängtes Pedal dazu. Von 2010 bis 2012 mietete die Landesmusikschule Ötztal für den Orgelunterricht in Umhausen das Instrument von der Orgelbaufirma Pirchner.
2012 wurde das Instrument von der Pfarre Umhausen im Ötztal für die Kaplaneikirche in Niederthai angekauft und dafür passend intoniert und adaptiert. Die Truhenorgel besitzt geteilte Register (Gedeckt 8‘ und Principal 4‘), u. a. auch ein Diskantregister (Cornett 2fach 22/3‘) ab cis1. Außerdem hat sie eine Transponiervorrichtung: die Tastatur ist um einen Halbton nach unter verschiebbar (a1 = 440 Hz / a1 = 415 Hz). Das Instrument ist gleichschwebend gestimmt, das Gehäuse ist aus geöltem Fichtenholz gefertigt.
Pfarrkirche Ötztal-Bahnhof
Erbauer: E. F. Walcker & Cie - Ludwigsburg, Stuttgart (D) Baujahr: 1955 Umbau: 2015-16, Rösel Orgelbau- Saalfeld, Thüringen (D) Standort: 1955-2015 Stadtsaal (Innsbruck), Empore; seit 2017 Pfarrkirche Ötztal-Bahnhof, Südempore Instrument: opus 3.340, 46-registrige dreimanualige, mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: elektrisch, Registerzüge
Der 1888 begonnene Bau der Innsbrucker Stadtsäle wurde 1890 fertiggestellt. 1891, kurz nach Fertigstellung des Gebäudes, bauten die Gebrüder Rieger aus Jägerndorf im heutigen Tschechien für den Stadtsaal eine erste neue 30-registrige, dreimanualige mechanische Kegelladenorgel mit Pedal. Im 2. Weltkrieg wurde das Gebäude durch Luftangriffe stark beschädigt. Nach dem Wiederaufbau der Stadtsäle fanden dort bis 2002 auch die Innsbrucker Gemeinderatssitzungen statt.
1955 errichtete die Orgelbaufirma E. F. Walcker & Cie aus Ludwigsburg einen 46-registrigen dreimanualigen mechanischen Schleifladen-Orgelneubau (als ihr opus 3.340) für den größten Saal. Die Disposition der Orgel stammte von Musikdirektor Kurt Rapf und Prof. Alois Forer, der auch bei der Einweihung am 20.01.1956 spielte.
Das Instrument mit insgesamt 3524 Pfeifen war damals die drittgrößte Orgel Innsbrucks, größte Konzertorgel westlich von Salzburg und - zu ihrer Erbauungszeit - die erste mechanische Schleifladenorgel in Österreich. Sie besitzt ein offenes Gehäuse mit Seiten- und Rückwänden aus massivem Holz. Die Spielanlage befindet sich als Spielschrank in der Prospektfront.
2015, im Zuge des Stadtsaal-Abbruchs, wurde sie von der Stadt Innsbruck an die Pfarre Ötztal-Bahnhof durch einen Schenkungsvertrag, basierend auf einen Grundsatzbeschluss des Stadtsenats vom 6.5.2015, übergeben. 2016-17 wurde das Instrument von Rösel Orgelbau aus Saalfeld in Thüringen gesäubert, restauriert und für den neuen Standort auf der Empore der Pfarrkirche Ötztal-Bahnhof in Tirol adaptiert.
Landeskrankenhaus Hochzirl, Hauskapelle
Erbauer: Josef Mertin - Wien (A) Baujahr: 1982 Standort: 1982-2012 Wohnung, Musikzimmer; ab 2012 Hauskapelle Landeskrankenhaus Hochzirl Instrument: 6-registrige einmanualige mechanische Orgel Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Josef Mertin, Orgelbauer, Organist, Sänger, Ensembleleiter und Pionier der alten Musik in Wien, baute 1982 für die Privatwohnung von Marianne und Ernst Kubitschek-Rônez in Dreiheiligen in Innsbruck ein einmanualiges 6-registriges mechanisches Schleifladen-Orgelpositiv. Es ist das letzte von ihm gebaute Orgelwerk.
Ursprünglich sollte es ein tragbares Instrument werden, im Zuge der Projektumsetzung mutierte es jedoch zu einer Hausorgel. Die Orgel besitzt ein assymetrisches Gehäuse aus massivem Nussholz mit seitlicher Spielanlage. Die Untertasten sind aus Obstholz, die Obertasten aus Ebenholz gefertigt.
Bei der Sesquialtera 11/3‘ kann auch nur die Quinte oder repetierende Terz gezogen werden; bei der dreifachen Zimbel 1‘ sind die drei Pfeifenreihen auch einzeln spielbar. 2012, nach einem längeren Aufenthalt und der Genesung von Ernst Kubitschek-Rônez im Landeskrankenhaus Hochzirl-Natters (Standort Hochzirl) übergaben Marianne und Ernst Kubitschek-Rônez dem Krankenhaus das Instrument als Dauerleihgabe für die dortige Hauskapelle.
Heilig Geist-Kirche, Matrei am Brenner
Erbauer: Anton Behmann - Schwarzach, Vorarlberg (A) Baujahr: 1895 Standort: 1895-1906 Hauskapelle der Evangelischen Gemeinde (zuvor Hauskapelle der k.k. Normalschule); seit 1907 Matrei am Brenner, Hl. Geist-Kirche (A) Instrument: 9-registrige zweimanualige mechanische Kegelladenorgel, freistehender Spieltisch (op. 54) Spieltraktur: mechanisch Registratur: Registerzüge
1768 wurde in der Kiebachgasse 10 eine Normalschule mit dazugehöriger Hauskapelle (mit barockem Zwiebelturm) errichtet, deren oberste Klassen für die Lehrerausbildung dienten. Die Schule war das Pilotprojekt für die sechs Jahre später in ganz Österreich eingeführte allgemeine Schulpflicht bzw. für die dafür notwendige Lehrerausbildung.
1877 übersiedelte die Schule in die größeren Räumlichkeiten des von 1874 bis 1877 neu gebauten Pädagogiums (heute BORG Innsbruck) in der Fallmerayerstraße 7. Die aufgelassenen Räumlichkeiten in der Kiebachgasse wurden 1878 an die zwei Jahre zuvor gegründete „Evangelische Kirchengemeinde A. und H.B., Innsbruck“ verkauft. Die dortige Hauskapelle wurde so zur ersten Pfarrkirche der Evangelischen Gemeinde, die in den darauffolgenden Jahren auf über 1000 Mitglieder anwuchs.
1895 baute der Vorarlberger Orgelbauer Anton Behmann für die Hauskapelle als sein op. 54 eine 9-registrige zweimanualige mechanische Kegelladenorgel. 1906 übersiedelte die Evangelische Gemeinde in das nach Plänen der Wiener Architekten Clemens Kattner und Gustav Knell neu gebaute Pfarrzentrum (mit Kirche und Pfarrhaus) in die Richard-Wagner-Straße 4 in Saggen. In der neu gebauten Evangelischen Christuskirche wurde die Orgelbaufirma G. F. Steinmayer aus Oettingenbeauftragt, eine neue, etwas größere Orgel zu bauen.
Die erst 11 Jahre alte Behmann-Orgel wurde noch im gleichen Jahr von der Evangelischen Gemeinde an den Orgelbauer Franz (II) Reinisch aus Steinach am Brenner verkauft. 1907 stellte sein Sohn Karl (II) Reinisch (er hatte gerade die Orgelbaufirma von seinem Vater übernommen) das Instrument in der Heilig Geist-Kirche (Spitalskirche) der Pfarre Matrei am Brenner auf und versah das Instrument im Zuge der Adaptierung auf der Empore der Kirche mit dem Reinisch-Firmenschild.
Das Instrument, das ein wichtiges Klangdokument aus der Zeit um 1900 ist und sich nahezu unverändert erhalten hat, ist derzeit nicht spielbar und befindet sich in einem leider desolaten Zustand. Die Balganlage ist im Dachgeschoß untergebracht, besitzt keinen Elektromotor und kann nur über eine Seilzugvorrichtung bedient werden.
Pfarrkirche St. Franziskus, Schönegg-Hall
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1996 Standort: 1996-2005 Stiftskirche Wilten, Altarraum; seit 2005 Altarraum Pfarrkirche Schönegg-Hall, Altarraum Instrument: 15-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Chorgebet in der Stiftskirche Wilten jahrzehntelang mit der ca. 1670 erbauten Herz-Orgel begleitet.
1996 baute die Steinacher Orgelbaufirma Reinisch-Pirchner eine neue 15-registrige zweimanualige mechanische Schleifladen-Chororgel mit Pedal; das Gehäuse des Instruments wurde dabei aus massivem Eichenholz gefertigt.
Im Zuge der von 2005 bis 2008 in der Stiftskirche Wilten durchgeführten Restaurierung stellte man auch das alte, noch vollständig erhaltene klassizistische Chorgestühl von 1791 wieder her. Für die Pirchner-Chororgel, welche an ihrem bisherigem Aufstellungsort den abgeänderten Zugang zum Chorgestühl versperrt hätte, konnte kein passender Ersatzstandort im Presbyterium gefunden werden.
Das Pirchner-Instrument wurde so 2005 nach Schönegg in Hall verkauft und dort in der Pfarrkirche St. Franziskus-Schönegg im linken Altarbereich aufgestellt.
Lindenkirche St. Georgenberg
Erbauer: Reinisch Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: ca. 1990 Standort: ca. 1990-2022 Zentrum 107, Innstraße 107, Innsbruck; seit 2022 Lindenkirche St. Georgenberg, Stans Instrument: 1-registriges einmanualiges, mechanisches Schleifladen-Orgelpositiv, transponierbar Spieltraktur: Stechermechanik Registratur: nicht vorhanden
1996 baute der Steinacher Orgelbauer Johann Pirchner eine 1-registrige mechanische Truhenorgel mit massivem Kirschholz-Gehäuse und verschließbaren Flügeltüren. Die Untertasten sind mit Grenadillholz belegt, die Obertasten aus Ahorn mit Knochenauflage gefertigt. Im Unterbau befinden sich der Elektromotor und ein einfaltiger Keilbalg.
Die Truhenorgel hatte ihren Standort im städtischen Kulturzentrum Zentrum 107 in St. Nikolaus in Innsbruck und konnte dort gegen eine Leihgebühr von Interessierten ausgeliehen werden.
2022 wurde das Instrument in den Altarbereich der Lindenkirche in St. Georgenberg, Stans übertragen.
Johanneskirche, Kufstein
Erbauer: Walcker-Mayer - Guntramsdorf, Niederösterreich (A) Baujahr: 1967 Standort: 1967-1979, Pfarrkirche St. Paulus, Altarraum; seit 1979 Johanneskirche Kufstein, Altarraum Instrument: 5-registrige einmanualige, mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Das kleine, einmanualige 5-registrige mechanische Orgelpositiv, erbaut 1967 von der Orgelbaufirma Walcker-Mayer aus Guntramsdorf in Niederösterreich und aufgestellt im Altarbereich der Pfarrkirche St. Paulus, wurde bereits 1979 an die Evangelische Gemeinde Kufstein verkauft.
In der Johanneskirche in Kufstein stellte die evangelische Gemeinde das Instrument auf der linken Seite im Altarbereich auf.
Filialkirche Siebending
Erbauer: Karl Reinisch‘s Erben - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1961 Standort: 1961-1999 Landeskrankenhaus Innsbruck, Kapelle; seit 1999 Filialkirche Siebending, St. Andrä im Lavanttal (Kärnten), Empore Instrument: 12-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Bereits im frühen 14. Jahrhundert entstand neben der Spitalskirche das erste Innsbrucker Stadtspital. Dessen Geschichte ist ab Mitte des 17. Jahrhunderts eng mit der Entwicklung der 1669 gegründeten Universität Innsbruck, welche von Anfang an auch über eine Medizinische Fakultät verfügte, verbunden.
1888 wurde das Spital an die Stelle des heutigen Landeskrankenhaus Innsbruck (Tirol Kliniken Innsbruck) verlegt. 1961 baute Orgelbauer Johann Pirchner aus Steinach am Brenner auf die Empore der Kapelle des Landeskrankenhauses Innsbruck eine 12-registrige zweimanualige Schleifladenorgel mit Hauptwerk, Rückpositiv und Pedal.
1999 musste der Klinikbereich, in dem sich die Landeskrankenhauskapelle befand, einem Neubau weichen. Die Pirchner-Orgel wurde abgebaut, an die Pfarre St. Andrä im Lavanttal in Kärnten verkauft und noch im gleichen Jahr in der Filialkirche Siebending auf der dortigen Empore aufgebaut. Das Instrument ist unverändert erhalten geblieben.
Stift Schlägl
Erbauer: Orgelbau Metzler & Söhne - Dietikon, Zürich (CH) Baujahr: 1973 Standort: 1973-1985 Höttinger Au, Wohnung; seit 1985 Stift Schlägl (OÖ), Musikzimmer Instrument: 3-registriges einmanualiges Schleifladen-Positiv Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Der Orgelforscher, Maschineningenieur und Bergführer Egon Krauss war als Orgelsachverständiger bis 1976 Konsulent des Bundesdenkmalamtes für Kirchenorgeln und -glocken in Wien. 1968 übersiedelte er nach Innsbruck.
Die Tiroler Orgellandschaft verdankt Egon Krauss viele Impulse in Bezug auf Restaurierungen historischer Orgeln und Neubauten, im Besonderen bei der Restaurierung der Daniel Herz-Chororgel und dem Neubau der großen Stiftsorgel von Gregor Hradetzky in der Stiftskirche Wilten sowie bei den Restaurierungen der Ebert-Orgel und der italienischen Orgel in der Hofkirche. 1973 baute die Schweizer Orgelbaufirma Metzler & Söhne für seine Innsbrucker Privatwohnung ein 3-registriges Orgelpositiv mit Flügeltüren und einem Orgelgehäuse aus massivem Eichenholz.
Als Krauss 1985 starb, wurde seine Orgel nach Oberösterreich ins Prämonstratenser Chorherrenstift Schlägl transferiert.
Pfarrkirche Stephanshart
Erbauer: Gregor Hradetzky - Krems, Niederösterreich (A) Baujahr: 1962-64 Standort: 1964-2005 2. Westempore; seit 2007 Pfarrkirche Stephanshart, Amstetten (NÖ) Instrument: 40-registrige viermanualige mechanische Schleifladenorgel, angebauter Spieltisch Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge
Das im Olympiajahr 1964 von der damals aufstrebenden Orgelbauwerkstätte Gregor Hradetzky aus Krems in Niederösterreich in der Stiftskirche Wilten errichtete viermanualige 40-registrige Instrument mit Pedal war die erste rein mechanisch erbaute viermanualige Schleifladenorgel Österreichs.
Der Gehäuseentwurf mit den zwei Rückpositiven in der Brüstung stammt vom Innsbrucker Architekten Josef Menardi. Das Gehäuse wurde von der klostereigenen Tischlerei hergestellt; die Orgeldisposition für diese ungewöhnliche Gehäuseanordnung erstellten Egon Krauss und Herbert Gollini. Die Schleifladen sind aus Mahagoniholz gefertigt. Die Windversorgung des Instrumentes erfolgt mit jeweiligen Regulierbälgen für die einzelnen Werke. Die großen Metallpfeifen baute man damals noch aus Elektrolyt-Zink.
Ab 1968 war die Steinacher Orgelbaufirma Reinisch-Pirchner für die Pflege und Wartung des Instrumentes zuständig. 2005, nachdem der Konvent einen Neubau der Chor- und Hauptorgel beschlossen hatte, erfolgte der Abbau der Orgel. 2007 wurde das Instrument von der Pfarre Stephanshart in Niederösterreich angekauft, von der Wiener Orgelbaufirma Franz Bodem generalsaniert und für die Empore der dortigen Pfarrkirche adaptiert. Der Bau der Pfarrkirche Stephanshart erfolgte 1956-59 nach Plänen der Architekten Franz Barnath und Josef Gruber.
Pfarrkirche Breitenfeld
Erbauer: Rieger Orgelbau - Jägerndorf (Krnov), Schlesien (CZ) Baujahr: 1931 (op. 2.500) Standort: 1931-1998 Dom zu St. Jakob, Empore; seit 2001 Pfarrkirche Breitenfeld, Josefstadt Wien Umbau: 1999-2001, Orgelbau Peter Maria Kraus, Lessach (A) Instrument: 66-registrige viermanualige pneumatische Orgel, freistehender Spieltisch Spieltraktur: elektropneumatisch Registratur: elektropneumatisch, Registerwippen
1931 baute Rieger Orgelbau aus Jägerndorf in Schlesien auf der Westempore der Pfarrkirche St. Jakob in Innsbruck eine neue 75-registrige viermanualige elektropneumatische Orgel. Im Zuge des geplanten Orgelneubaus durch Orgelbau Pirchner wurde die Orgel 1999 aus dem historischen Humpelgehäuse von 1725 ausgebaut und (ohne das 10-registrige Fernwerk im Gewölbe) nach Breitenfeld in der Josefstadt in Wien transferiert.
Der mit der Aufstellung der Orgel beauftragte Orgelbauer Peter Maria Kraus aus Lessach im Salzburger Lungau baute die Rieger-Orgel auf der etwas kleineren Empore der Pfarrkirche Breitenfeld einschneidend um: von 1999-2001 schuf er aus den vorhandenen Orgelbauteilen und ursprünglich 65 Registern (ohne Fernwerk) eine kleinere 56-registrige Orgel mit Hauptwerk, Schwellwerk, Unterwerk (statt dem ursprünglich 16-registrigen zweiten Schwellwerk) und Pedalwerk mit einem neuen Orgelgehäuse aus Eichenholz, setzte den Windruck herab (von ursprünglich 90 mmWS auf 70 mmWS im Hauptwerk und Schwellwerk, 60 mmWS im Unterwerk) und stattete die Orgel mit einen neuen Setzeranlage der Fa. Laukhuff aus.
2010 baute Orgelbauer Peter Maria Kraus für das Instrument das 2001 zwar vorgesehene, aber noch fehlende 10-registrige Fernwerk neu dazu und verwendete dafür Teile der einstigen Innsbrucker Domorgel sowie von einer Orgel von Haag in Niederösterreich. 2022-23 führte Andreas Seul Orgelbau aus Hüttenberg in Deutschland eine Spieltischsanierung und Erneuerung der Elektrik durch.
Kunsthistorisches Museum Wien
Erbauer: Servatius Rorif - Innsbruck (A) Baujahr: ca. 1564-69 Standort: ursprünglich Schloß Ambras; heute Kunsthistorisches Museum Wien Instrument: 18-registriges einmanualiges, mechanisches Claviorganum (mit mehreren Effektregistern) Spieltraktur: mechanisch, Stechermechanik Registratur: mechanisch, Registerzüge
Der Instrumentenbauer, Organist und Komponist Servatius Rorif arbeitete ab 1561 als Orgelbauer und Organist in Augsburg. Von 1566 bis 1587 wirkte er als Hoforganist in Innsbruck. Nach seiner Pensionierung war er noch bis zu seinem Tode im Jahr 1593 Organist in Neustift bei Brixen in Südtirol.
Rorif, der am Innsbrucker Hof sehr angesehen war, fertigte von 1564 bis 1569 ein Claviorganum mit Saiten und Pfeifen für Schloss Ambras. Das 1596 im Ambraser Inventar erwähnte Instrument ist sehr kompakt und raffiniert gebaut und besitzt mit den Scherzregistern die unglaubliche Anzahl von 18 Registern!
Die beiden Register Gedackt 4‘ und Flöte 2‘ sind in zwei Reihen hintereinander auf der Rückseite des Gehäuses angeordnet, die Pfeifen des Gedackt 8‘ liegen in Blöcken horizontal unter dem Spinett. Die Untertasten sind mit Elfenbein, die Obertasten mit Laubholz belegt; die Tastenfronten der Untertasten sind vergoldet und mit hölzernen Halbkreisornamenten ausgestattet.
Die Registerzugstangen befinden sich rechts und links von der Klaviatur, die Abschaltung des Spinetts erfolgt durch einen Hebel links hinten am Gehäuse. Die Windversorgung erfolgt durch zwei fünffaltige Keilfaltenbälge (L: 100 cm, B: 18,5 cm, D: 1,3 cm). Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurde das Claviorganum nach Wien transferiert; es kann dort im Kunsthistorischen Museum (Neu Burg, Saal 10) besichtigt werden. Es ist das älteste erhaltene Claviorganum der Welt und gilt als einzigartiger Orgelschatz!
Warschau (Privat)
Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1986 Standort: 1986-2021 mobil / Universitätsstraße 1; seit 2023 in Warschau, Polen, Privatbesitz Instrument: 4-registriges einmanualiges mechanische Schleifladen-Truhenorgel, transponierbar Spieltraktur: Stechermechanik Registratur: mechanisch, Registerschieber
Die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, veranstaltet seit 1976, entwickelten sich aus den bereits seit 1964 durchgeführten Amraser Schlosskonzerten. Schwerpunk des alljährlich stattfindenden renommierten Festivals ist die Pflege der Renaissance- und Barockmusik sowie gegebenenfalls auch der Musik der Wiener Klassik.
1986 baute die Steinacher Orgelbaufirma Reinisch-Pirchner für die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik eine 4-registrige mechanische Truhenorgel mit massivem Kirschholz-Gehäuse und verschließbaren Flügeltüren. Die Untertasten sind mit Grenadillholz belegt, die Obertasten gefertigt aus Ahorn mit Knochenauflage. Im Unterbau der Orgel befindet sich der Elektromotor und ein einfaltiger Keilbalg. Die mobile Truhenorgel wurde bis 2020 nach Bedarf bei diversen Aufführungen des Festivals verwendet.
Nachdem vom Festival Innsbrucker Festwochen der alten Musik im Jahr 2020 zusammen mit dem Innsbrucker Jesuitenkolleg und dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum vom italienischen Orgelbauer Giovanni Pradella aus dem Veltlin bei Sondrio eine neue 5-registrige einmanualige Truhenorgel angekauft worden war, erfolgte 2021 der Verkauf des Pirchner-Instrumentes in die Provinz Brescia in Italien. Seit 2023 befindet sich die 4-registrige Pirchner-Truhenorgel, nach einem erneuten Weiterverkauf, im Privatbesitz in Warschau (Polen).
Paul-Hofhaimer-Preis
Aus Anlass der 450. Wiederkehr des Todestages von Kaiser Maximilian I. hat die Stadt Innsbruck erstmals im Jahre 1969 den „Paul-Hofhaimer-Preis“ für die Interpretation von Orgelkompositionen alter Meister gestiftet. Der international ausgeschriebene Orgel-Wettbewerb findet alle 3 Jahre in Innsbruck statt und wird seit dem Jahr 2021 vom Kulturamt der Stadt Innsbruck organisiert. Der Wettbewerb wird öffentlich in Kirchen durchgeführt, wobei die BewerberInnen auf historischen Orgeln spielen. Eine international besetzte mehrköpfige Fachjury, bestehend aus OrganistInnen, entscheidet über die Vergabe. Die Vorführungen im Rahmen des Wettbewerbes können vom Publikum kostenlos besucht werden!
Zur Person Paul Hofhaimer
Geboren am 25. Jänner 1459 zu Radstadt, war Paul Hofhaimer eng mit dem Hofleben Kaiser Maximilians I. verbunden. Hofhaimer diente am kaiserlichen Hofe Friedrichs III. in Graz, bevor er 1478 erstmals am Hof von Erzherzog Sigmund von Tirol als Organist seine Tätigkeit aufnahm. Sigmunds Nachfolger, König und Kaiser Maximilian I., übernahm Hofhaimer mitsamt der Hofkapelle. In dessen Gefolge führten ihn zahlreiche Reisen durch das Reich u. a. nach Linz, Wels, Wien, Augsburg, Ulm, Konstanz, Füssen und Freiburg. Um 1509 ließ er sich in Augsburg nieder. Nach dem Tode seines Dienstherrn im Jahre 1519 wurde auch die Hofkapelle aufgelöst. Vermutlich ging Hofhaimer vorerst nach Passau, 1522 ist er in Salzburg nachweisbar. Hier starb er 1537 und fand auf dem Friedhof Sankt Peter seine letzte Ruhestätte.